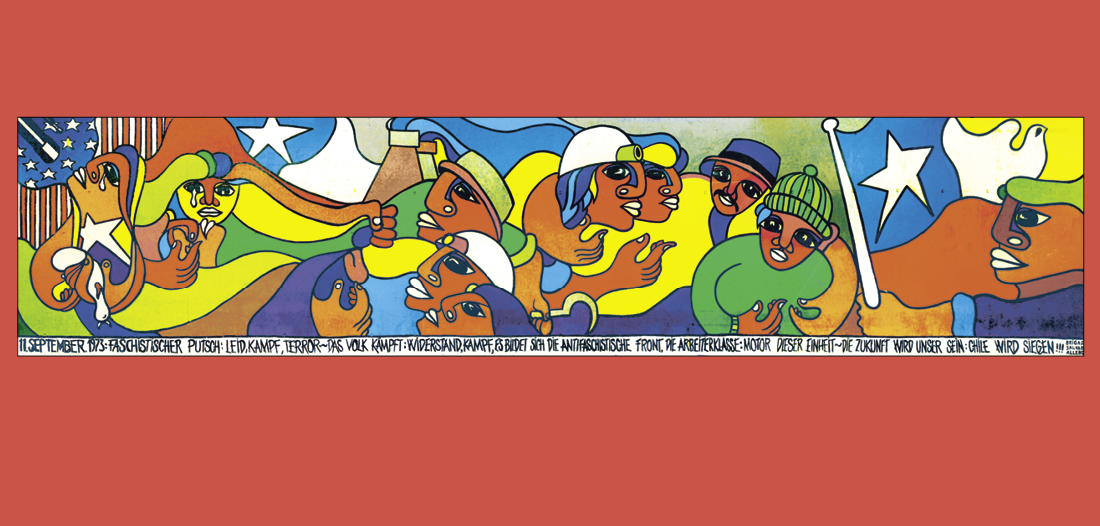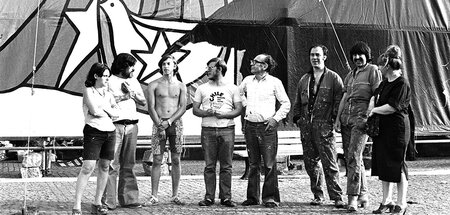Über Chile zum Zeitpunkt des faschistischen Putsches gegen die Regierung Allende und die Zeit danach. Ein Gespräch mit Günter Küpper
Zum Zeitpunkt des Putsches des faschistischen Generals Augusto Pinochet gegen die Regierung der Unidad Popular und den gewählten Präsidenten Salvador Allende vor genau 50 Jahren arbeiteten Sie in der Botschaft der DDR in Santiago de Chile. Was bedeutet der 11. September für Sie?
Es war ein einschneidender Tag. Ich habe den ganzen Putsch hautnah miterlebt, da ich zufällig wieder Nachtdienst hatte. Der Tag war schon insgesamt etwas unruhig, und ab zehn Uhr verdichteten sich die Hinweise, es könnte einen erneuten Putschversuch geben. Dem 11. September waren ja schon einige Anläufe vorangegangen. Ich hatte das Radio eingeschaltet und habe die ganze Nacht hindurch zugehört. Ich habe keine Minute geschlafen. Irgendwann kamen immer mehr Mitteilungen, dass von der Hafenstadt Valparaíso Seeleute auf die Hauptstadt Santiago zumarschieren. In den frühen Morgenstunden, so gegen vier, hieß es, es seien Panzer aus der Kaserne gefahren.
Um sechs Uhr habe ich dann die Leitung informiert – das waren damals der Botschafter und der Handelsrat, dass es etwas Größeres sein könnte und sie zeitnah in die Botschaft kommen müssen. Ich erklärte ihnen, dass wir schnell handeln müssten, falls notwendige Maßnahmen zu ergreifen sind.
Das klingt beängstigend! Was passierte dann?
Am Vormittag ging alles Schlag auf Schlag: Erst waren Flugzeuge über Santiago zu sehen. Vom Botschaftsdach aus konnten wir sehen, wo die ungefähr hinflogen. Dann hörten wir die Einschläge in der Residenz von Präsident Allende, und in der »Moneda«. Über das Radio wurde bekanntgegeben, dass Allende in »La Moneda«, dem Präsidentenpalast sei. Diese sei von Panzern umstellt, und es werde geschossen. Dann wurde von Pinochet der Befehl gegeben, Allende solle mit allen Mitarbeitern rauskommen. Allende hat als Staatspräsident alle Beschäftigten aufgefordert, sich den Putschisten zu ergeben und ist mit den Worten »mich kriegen sie nicht« drinnen geblieben. Kurz darauf wurde verkündet, Allende sei tot, er habe sich erschossen. Das war für uns eine furchtbare Mitteilung. Tragisch!
Wie hat die Botschaft auf diesen Schock reagiert?
Wir mussten natürlich reagieren und tausende Sachen in die Wege leiten. Das erste war: Wie sichern wir alle Mitarbeiter, und wie holen wir die Leute nach Santiago, die außerhalb sind? Dann die Frage: Wie können wir helfen? Wo müssen wir dafür hin – kommen die Autos überall hin? Es musste alles organisiert werden. Ich habe die gesamte Administration gemacht. Alles, was sich bewegte in der Botschaft, ging über meinen Tisch oder lief über meine Mitarbeiter.
Die Regierung der Unidad Popular veränderte vieles zu der Zeit in Chile. Welche von Salvador Allendes Entscheidungen bewerten Sie aus heutiger Sicht als sinnvoll?
Der ganze Zug, der in Bewegung gebracht wurde, war sinnvoll. Das war ein bisschen wie Kuba, das war ein bisschen Sowjetunion, das war ein bisschen von uns. Allende hatte Ahnung, er war ja schon zum dritten Mal als Präsidentschaftskandidat angetreten. Er war kein Neuling und wollte einen demokratisch sozialistischen Staat aufbauen. Doch er stand inmitten von Raubtieren: Die USA und ihre Handlanger waren überall. Deshalb musste sich die Unidad Popular durchkämpfen. In der ersten Phase, die ich bewusst erlebt habe in den Jahren 1972/73, gab es viele Erfolge und eine große Begeisterung im Land. Es wurde alles umgestaltet. Die Jugend lernte, die Studenten lernten. Die Menschen waren so begeistert.
Auch außerhalb Chiles?
Die westliche Welt konnte gar nicht so schnell reagieren, so rasant wie Chile sich veränderte und entwickelte. Was das Schlimmste für das Kapital war: Die beiden Kupferminengesellschaften der USA wurden verstaatlicht. Das war von Allende planmäßig vorbereitet worden, damit das Vermögen im Land bleiben konnte. Chile sollte den Chilenen gehören, das war sein Credo. Aus Sicht der Vereinigten Staaten war das schrecklich, denn sie nutzten Lateinamerika als Vorratskeller. Heute ist das für sie nicht mehr nur Südamerika, heute rauben sie Ressourcen weltweit. Damals war das also ein richtiger Schlag, davon mussten sich die USA erst mal erholen. Unmittelbar begannen sie, dagegen zu kämpfen, verbreiteten Lügen und haben die Leute aufgehetzt. Die CIA verteilte Gelder an Privatpersonen und Unternehmen für Aktionen gegen Allende. Es gab beispielsweise organisierte Straßenblockaden. Korrumpierte Lkw-Fahrer haben die Panamericana dicht gemacht und Reifen angezündet. Die ganzen sogenannten Streiks, die stattfanden, waren von den USA geplant und finanziert.
Welche Auswirkungen hatten diese US-finanzierten Aktionen?
Durch die Straßenblockaden und Streiks wurde auch in Santiago das Essen verknappt, die Verkehrsmittel wurden eingeschränkt. Mit unseren Diplomatenfahrzeugen war es uns noch möglich einzukaufen, was es in der Stadt sonst nicht mehr gab. In der Hauptstadt lebte ein Drittel der chilenischen Bevölkerung, und es hieß, wer Santiago in der Hand hat, hat das Land in der Hand.
Das eigentliche Ziel der Reaktion war, Chaos zu verbreiten. Dadurch hatte die Junta dann die Möglichkeit, Allende zu unterstellen, er könne den Staat nicht leiten, und das Militär müsse einschreiten. Das war das Ziel der USA und ihrer Verbündeten. Die Reaktion der ganzen Welt richtete sich geballt gegen Chile und gegen die Solidarität mit Allendes Regierung. Diese Solidarität war zwar sehr groß, aber sie konnte den faschistischen Putsch nicht verhindern.
Übrigens: Die Flugzeuge, die über Santiago flogen, waren von der BRD geschickte Luftakrobaten. Diese haben Aufnahmen gemacht, was wo bombardiert werden könnte. Davon habe ich Bilder, die Flugstaffel habe ich fotografiert. Ich bin im Nachgang des Putsches auch oft gefragt worden: »Habt ihr Waffen gehabt«?
Und? Hatten Sie Waffen?
Also, ich weiß bloß, dass der kubanische Botschafter ein MG hatte. Aber was soll sowas gegen Panzer bringen? Da hat unser Botschafter zu ihm gesagt »Lasst den Unsinn!« Und die Kubaner haben auf die DDR gehört. Aber was wäre gewesen, wenn wir Waffen gehabt hätten? Die Finnen haben immer gemutmaßt, wir hätten ein riesiges Arsenal Waffen in der Botschaft. Mein Freund, der finnische Vizekonsul, wollte immer wissen, was wir im Keller haben. Dann hat ihm ein Genosse von der Staatssicherheit den Keller mal gezeigt, damit sich das Thema endlich erledigt (lacht).
Sie haben eben gesagt, dass es bereits vereitelte Putschversuche gegeben hatte. Hatten Sie denn in den Wochen und Tagen davor eine böse Vorahnung?
Die Möglichkeit eines Putsches bestand immer. Das wussten wir, das wusste Allende, das wussten alle. Nur wie genau er angezettelt werden würde, das wusste niemand.
Heute ist klar, dass die USA und der Auslandsgeheimdienst CIA ihre Finger im Spiel hatten. Was wussten Sie damals darüber?
Wir wussten, dass die großen Konzerne, die in Chile sind, natürlich mit den USA zusammenarbeiten. Die Kupferminen wurden ja, wie gesagt, enteignet. Uns war natürlich auch klar, dass die USA das nicht so ohne weiteres hinnehmen würden. Wir haben damit gerechnet, dass sie darauf hinarbeiten würden – und hinarbeiteten –, Chaos zu verbreiten.
Auf den Putsch folgte eine dreitägige Ausgangssperre …
Wir hielten uns in der Botschaft und unserer Schule, außerdem in Wohnungen auf. Im Land wurde geschossen – Tag und Nacht: Pinochets Anhänger mussten jede Nacht ihre Gewehre leer schießen. Um unsere Botschaft herum waren Scharfschützen stationiert und konnten von dort aus den Hof des Gebäudes überwachen. Im »Notfall« hätten sie auch von dort oben in die Botschaft schießen können.
Was hat die Militärjunta mit Kommunisten gemacht?
Sie wurden eingesperrt und ermordet. Wenn wir in die Stadt gefahren sind, waren immer Leichen im Mapocho (Fluss durch Santiago, jW) zu sehen. Die haben die Leute ganz einfach umgebracht. Bei uns suchten Verfolgte, die mit dem Tod bedroht waren – das betraf Minister, Senatoren, Künstler sowie den Schwiegersohn von Erich Honecker – Schutz. Später kamen dann auch Menschen, die zuerst in Konzentrationslagern gefangen waren und irgendwie rausgekommen sind.
Also sind Leute aus den Konzentrationslagern in die Botschaft als politische Geflüchtete gekommen?
Ja. Die haben schreckliche Sachen erzählt! Im ganzen Land wurden Lager errichtet. Für mich ganz persönlich das dramatischste war die Ermordung eines unserer Fahrer. Den hatte ich eingestellt, ein ganz toller Typ. Er hatte ein Kleinkind, das war etwa ein Jahr alt. Eine Woche nach dem Putsch kam seine Frau, ganz in Schwarz, mit dem Kind zu mir. Sie hatte ihren Mann drei Tage lang gesucht und dann erschossen in einer Avenida gefunden, auf dem Mittelstreifen.
Die meisten Mitarbeiter der Botschaft reisten ab, Sie aber blieben.
Am 17. September 1973, knapp eine Woche nach dem Putsch, flog ein Flugzeug mit den führenden Mitarbeitern, dem Botschafter, Gesandten und politischen Mitarbeitern, nach Hause. Der Rest wurde am 23. September zurück nach Berlin geflogen. Ich musste bleiben, weil ich die Unterschriftsberechtigung in den chilenischen Banken hatte. Ich habe dadurch verfolgen können, wie Pinochet das Land verkauft hat. Er hat alles zu Geld gemacht: selbst das Wasser, die Wasserläufe wurden durch die Putschregierung verkauft.
Gab es Ideen und Strategien der SED, auf den Staatsstreich zu reagieren?
Na, wir haben die diplomatischen Beziehungen unterbrochen, weil ein DDR-Bürger misshandelt wurde. Damit wurden die Beziehungen weitestgehend eingestellt. Dann haben wir uns darum gekümmert, Verfolgte zu schützen und außer Landes zu bringen, die bei uns Asyl suchten.
Wie viele Leute suchten Schutz in der Botschaft?
Ich habe insgesamt 127 Personen betreut, die sich zu uns geflüchtet hatten. Mit den letzten sechs habe ich sieben Monate zusammengelebt, wie eine Familie. Darunter war Allendes Anwalt, es waren viele Kommunisten und Künstler. Die meisten der geflüchteten Chilenen konnten nach und nach in die DDR ausfliegen, und sie waren dort dann in Sicherheit. Mit den sechs bis zuletzt in der Botschaft Verbliebenen haben wir uns richtig angefreundet und hatten auch später in der DDR noch Kontakt.
Günter Küpper war von 1972 bis 1977 Leiter der Administration in der DDR-Botschaft in Chile