Die gläserne Wand
Von Matthias Reichelt
Eine Frau presst ihre Hände und die rechte Wange an eine Glasscheibe und blickt die Betrachter an. »Ich möchte hier raus!«, ist mit zarter Schrift unterhalb des Halses auf der Scheibe zu lesen. Eine Fotoarbeit der österreichischen Künstlerin Birgit Jürgenssen (1949–2003) von 1976, die überzeugend die gläserne Wand symbolisiert, die Frauen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen ausschloss. Eine von Männern dominierte Gesellschaft, die vor allem im Kapitalismus Frauen den Zugang zu vielen Berufen verschloss und sie auf Mutterschaft und Haushalt reduzierte. Das konservative Bild der Frau wurde mit der Alliteration »Kinder, Küche, Kirche« zusammenfassend beschrieben. In den sozialistischen Ländern hingegen waren die Frauen früh gleichgestellt und konnten viele Berufe ausüben, die ihnen in kapitalistischen Ländern lange verschlossen blieben. Verheiratete Frauen mussten dort lange Zeit die Erlaubnis des Ehemannes einholen, um überhaupt einen Beruf ausüben zu dürfen. Doch auch in den sozialistischen Ländern waren Frauen mit Beruf und Familie aufgrund der ignoranten Haltung vieler Männer oft einer Doppelbelastung ausgesetzt.
Die »unsichtbaren« Restriktionen und Hindernisse aus gesellschaftlichen Vorurteilen, patriarchaler Struktur bis hin zu Misogynie, sorgten dafür, dass Frauen auf vielen Ebenen benachteiligt, ausgeschlossen oder ignoriert wurden, so auch im Kunstbetrieb. In Literatur und Kunst rebellierten dagegen Autorinnen wie Gisela Elsner, Elfriede Jelinek oder Valerie Solanas. Zeitschriften wie Die Schwarze Botin und Courage entstanden als Ausdruck einer neuen linken Frauenbewegung. Internationale Künstlerinnen, die es immer gegeben hatte, die aber von Museen und Sammlungen oft ignoriert worden waren, traten Ende der 60er und 70er Jahre wesentlich selbstbewusster auf. In radikalen, manchmal auch wütenden, oft von Ironie, Humor, Sarkasmus getragenen Werken, kritisierten sie die Reduktion von Frauen auf Sexualität und Ehe. Sie ebneten den Weg für die allmähliche Öffnung des vorwiegend von Männern kontrollierten Kunstbetriebs. Der britische, in den USA lebende Kunstkritiker Lawrence Alloway definierte die »Frauenbewegung in der Kunst« der 70er Jahre ausdrücklich als Avantgarde, »da ihre Protagonistinnen in ihrem Drängen auf eine Veränderung der bestehenden sozialen Ordnung in der Kunstwelt vereint sind«.
Im Sprengel-Museum Hannover gastiert zur Zeit die spannende Ausstellung »STAND UP! Feministische Avantgarde« mit circa 150 Werken, unter anderen von Helena Almeida, Renate Bertlmann, Judy Chicago, Valie Export, Sanja Iveković über Orlan, Ewa Partum, Annegret Soltau bis zu Hannah Wilke und Jana Želibská aus der Sammlung der Verbund AG, dem größten Energieunternehmen Österreichs. Die 1961 in Wien geborene Gabriele Schor, Kunstkritikerin und Kuratorin, promovierte über Alberto Giacometti und ist Gründungsdirektorin der seit 2004 von ihr aufgebauten Sammlung. Von Beginn an bestimmte sie die feministische Avantgarde als Zweck und Ziel der Sammlung, da die von Frauen produzierte Kunst lange Zeit vielerorts noch stiefmütterlich behandelt wurde. So gab sie der Sammlung einen unverwechselbaren Charakter. Die eingangs mit ihrer Glasarbeit erwähnte Birgit Jürgenssen steht da nicht allein.
Die 1948 in Kuba geborene, in New York mit dem Bildhauer Carl Andre zusammenlebende Künstlerin Ana Mendieta kam während einer Auseinandersetzung mit Andre durch einen Sturz aus dem 34. Stock ums Leben. Die näheren Umstände sind bis heute ungeklärt. Mendieta und später die 1942 in Ungarn geborene Katalin Ladik drückten jeweils eine Glasscheibe auf ihr Gesicht und erzeugten somit verunstaltende Grimassen, die dem gesellschaftlich geprägten weiblichen Schönheitsideal auf drastische Weise widersprachen.
Penny Slinger kostümierte sich für eine Fotoperformance als Hochzeitstorte mit angewinkelten und gespreizten Beinen und abnehmbaren Tortenelementen über Vagina und den Brüsten. Ein sarkastisches Bild des weiblichen Körpers als Objekt und Besitz des (Ehe-)Mannes, legitimiert durch die Hochzeit, ihm per Gesetz permanent zur Verfügung stehend. Die polnische Medien- und Performance-Künstlerin Ewa Partum positionierte 1980 in der Collage »Selbstidentifikation« ihren nackten Körper direkt vor eine uniformierte Polizistin, die ein Warschauer Standesamt bewacht. Die 1941 in den USA geborene Lynda Benglis veröffentlichte ein Selbstporträt, das sie nackt in provokanter Pose mit einem riesigen Dildo zwischen den Schenkeln zeigt. Sowohl eine Selbstermächtigung als auch ein Seitenhieb auf die vom männlichen Blick gesteuerte Bildrepräsentanz des weiblichen Körpers. Das Bild schaltete sie als Anzeige im November 1974 in der maßgeblichen Kunstzeitschrift Artforum, Teile der Redaktion distanzierten sich daraufhin von dem Bild bzw. traten zurück.
»STAND UP! Feministische Avantgarde«, Werke aus der Sammlung Verbund, Wien, Sprengel-Museum Hannover, bis 28. September
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
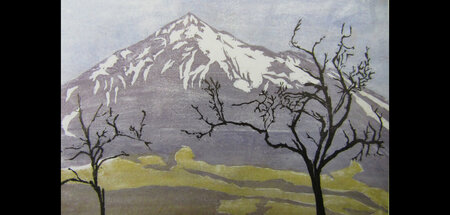 gemeinfrei10.01.2025
gemeinfrei10.01.2025Künstlerin mit feministischem Anspruch
 Margaret Raspé27.03.2023
Margaret Raspé27.03.2023Backe, backe Kuchen
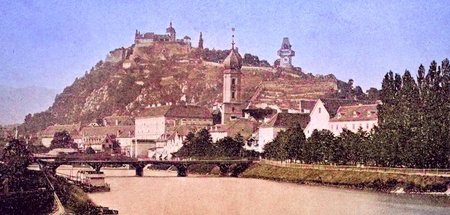 imago/imagebroker16.05.2022
imago/imagebroker16.05.2022Amazonen und Erektionen
Mehr aus: Feuilleton
-
Unterm Hammer
vom 10.09.2025 -
Hoelzke, Henckels, Adorf
vom 10.09.2025 -
Autobahn zum Himmel
vom 10.09.2025 -
Sein wichtigster Wechsel
vom 10.09.2025 -
Rotlicht: Palantir
vom 10.09.2025 -
Nachschlag: Einer der besten
vom 10.09.2025 -
Vorschlag
vom 10.09.2025 -
Veranstaltungen
vom 10.09.2025
