Doom macht glücklich
Von Ken Merten
Wer hin und her pendelt zwischen stinkender Faulheit und Arbeitssucht, Hedonismus und Masochismus, verbringt seinen Urlaub auf einem Metalfestival. (Und schreibt gegebenenfalls drüber.) Nirgends sonst liegen Genuss und Folter so nah beieinander, sind Lotterleben und Anstrengung so verzahnt. Jedes der unbezahlbaren Vergnügen ist teuer erkauft, sei es mit Euros, Hirnzellen, Trommelfellen oder sonstigen körperlichen Versehrungen.
Anfang August also geht es nach Belgien, zum Alcatraz Hard Rock & Metal Festival. Seit 2008 findet das Krachfest statt, erst in Deinze und seit 2013 im flämischen 80.000-Seelen-Städtchen Kortrijk. Vom Tagesevent ist Alcatraz sukzessive zu einem belgischen Wacken gewachsen. Ich hatte noch nie davon gehört, als ich Anfang des Jahres von einem Sandkastenfreund gefragt wurde, ob ich mitwöllte. Er und zwei seiner Nachbarn hatten beschlossen, Alcatraz in diesem Jahr aufzusuchen. Ich empfand große Angst, sagte aber nach einiger Bedenkzeit zu – sollte es halt das letzte sein, was ich tue, und mich der Blastbeat ins Jenseits wehen. Schließlich ist man nicht mehr Anfang 20.
Von Hannover aus begibt sich unser Quartett nach Westflandern, das Auto brechend voll mit Zelten, Campingstühlen, Proviant und der Ungewissheit, wie die kommenden vier Tage wohl ausfallen würden. Denn es gibt viele Feinde des Metalheads, die ihm das orchestrierte Biwak vermiesen könnten: Regenguss und Sonnenterror, ekelhafte Dixieklos und Gewaltmärsche vom Campingplatz zu den Bühnen, ohrschwache Soundtechniker und nervtötende Zeltnachbarschaft. Keiner von uns war jemals in Kortrijk, und unsere Hoffnungen erhielten einen ersten Schlag, als die Links zu den gebuchten Tickets auf sich warten ließen und erst wenige Tage vor dem Festivalbeginn im Postfach landeten. Das roch etwas nach Betrug, war aber bloß Chaos.
Angekommen roch es noch nach etwas anderem: Tod. Das Festival findet trefflich direkt neben dem örtlichen Krematorium statt. Wer im Moshpit über den Jordan geschubst werden sollte, kann hier gleich eingeäschert werden. Zwischen Campinggelände und Bühnenbereich liegt wohlsortiert der Friedhof. »Reverend, reverend, is this a conspiracy?« (Pantera: »Cemetery Gates«)
Uns wird ungekanntes Vertrauen entgegengebracht: Das Polizeiaufgebot ist minimal, ebenso die Anzahl der Securitys, die am Eingang des Camps gar nicht erst auf die Idee kommen, die vorauseilend gehorsam geöffneten Taschen zu filzen. Die grundsätzliche Angst, dass sich hier Kuttenträgerinnen und -träger erst den Glasflascheninhalt einverleiben, um dann im Rausch mit Flaschenhälsen und Klappmessern aufeinander einzustechen, schien nicht besonders ausgeprägt.
»Leichenfeldbetrachtung«
Vielleicht hat man in Belgien fleißig Frank Schäfers »Heavy Metal – Geschichten, Bands und Platten« (2001) gelesen, der darin unter anderem zwischen Metal und »barocker Vanitas-Literatur« der »Leichenfeldbetrachtung« Parallelen sieht: »Das ästhetische Spiel, die Betrachtung des Eigenen im Fremden der Kunst zieht eine Katharsis nach sich, und die wiederum eine intakte Seelenhygiene. Heavy Metal als Laxativ für eine gesunde Verdauung der Psyche.« Wer ein Cannibal-Corpse-Shirt trägt und Krachhymnen über Mord und Totschlag bewusst genießt, ist mit sich und der chronisch unwirtlichen Umwelt vielleicht mehr im Reinen als die durchschnittliche Kaiserianerin oder der Otto-Normal-Helenist mit spießigem Klemmsadismus und brodelnden Gewaltfantasien. Mein Sandkastenfreund hegt dennoch pädagogische Zweifel, ob es sinnvoll sei, seine Kinder im Vorschulalter auf ein Fest mitzunehmen, wo auf jedem dritten Nicki eine arg zugerichtete, meist weibliche Leiche prangt. Man komme da aus dem Erklären gar nicht mehr heraus, während man es selbst doch kaum begriffen hat.
Dazu braucht man die Atemluft für den Transport des mobilen Heims samt Vorratsschrank: Nassgeschwitzt und klappbollerwagenziehend erreichen wir den uns zugewiesenen Platz. Es ist natürlich die hinterste Zeltreihe, aber schon jetzt stellen wir fest, dass die Wege überschaubar sind – und dass das Dosenbier bereits seine festivalcharakteristische Pisswärme erreicht hat. Neben uns kampieren junge Niederländer. Sie berichten davon, dass da, wo sie herkommen, absolut jeder alkoholabhängig und suizidal sei. Wir zünden die ersten ungekühlten Hülsenfrüchte und tauschen uns aus, wer welche Band auf dem Zettel hat.
»Heavy Metal«, schreibt Schäfer, »ist eine akustische Blaupause der verrohten kapitalistischen Gesellschaft – und vielleicht ist es doch nicht nur Zufall, dass er just in dieser Weltsekunde zu seinem sinistren Grabesgesang anhob, als die Hippie-Illusion von Liebe und Brüderlichkeit und der kollektive Traum von der spirituellen Heilung der Industriegesellschaft gerade gestorben war.« Wer statt Plörre auf Badetemperatur gekühlte Getränke und statt lauwarmer Ravioli wenigstens in Mayonnaise ersoffene Fritten haben will, muss tief in die Tasche greifen und vorher Geld gegen Coins tauschen, die perfiderweise auch nicht einzeln erworben werden können, was bedeutet: Wer Coladurst verspürt, muss mindestens Coins im Wert von zehn Colas kaufen. Die Preise schmerzen, aber ganz auf die Hopfenkaltschale und den frittierten Snack verzichten würde dem Prinzip entgegenlaufen, dass es – hier lässt sich Hanns Eisler grundsätzlich widersprechen – zu Musik oft sehr schmeckt und es im Ohr todesengelsgleich klingelt, wenn das Hirn etwas in Alkohol planscht.
Katharsis am Arsch
Entsprechend sind die Spiele am Donnerstag abend eröffnet: Zwischen den Leopoldsburger Thrashern Evil Invaders und dem Headliner des ersten Tags, den New Yorker Urgesteinen Overkill, werden zum Preis von drei Coins stecknadelkopfgroße Döner verhaftet und belgisches Bier verköstigt. Vor der Bühne wird gekippt, auf der Bühne auch, wenn der Thrash Metal von Bobby »Blitz« Ellsworth und Konsorten mit Punkrock und Power Metal kokettiert.
Der Freitag dagegen beginnt musikalisch schrecklich: Auf dem Zeltplatz wagt sich jemand beim Karaoke an Bon Jovi heran. Katharsis am Arsch: Mordlust kommt auf. Morden tut auch der Temperaturabfall bei Nacht: Mehrmals habe ich mich im Schlafsack wachgezittert. »Livin’ on a Prayer« nun lässt auch frösteln, und leider filtern meine Ohrstöpsel das Gejammer nicht raus, also bleibt nur, darüber zu lachen.
Bei Heriot wiederum büße ich mit den Earplugs zuviel Klang ein: Das 2014 im englischen Swindon gegründete Metalcorequartett liefert zwar solide, doch die Leadgitarre sehe ich bloß und höre sie nicht. Frontfrau Debbie Gough und ihre Jungs bekommen am späten Mittag Beachtung, obgleich sie sich die Aufmerksamkeit mit der kalifornischen Nu-Metal-Band Snot teilen müssen. Der alten Kutte ohne ein Gramm Fett und mit Vogelnest auf dem Kopf gefällt Heriot sogar prächtig, bevor ihn die Pansen tragenden Skeptizisten in seiner Bezugsgruppe bekehren und sie gemeinsam abwandern. Wohin? Vielleicht reißen sie das schwächste Rudelmitglied und opfern das hautüberzogene Gerippe Chtulhu.
Spiel, Spaß, Spannung
Der schwedische Deathcore-Nachwuchs Thrown ist zwar live top, war aber Vorband auf so gut wie jedem Konzert, das ich in den letzten drei Jahren besucht habe. Phil Campbell and the Bastard Sons wecken in mir die bislang wenig reflektierte Furcht vor hinterbliebenen Musikern, die ihre Musik von einst (Motörhead) covern. Also verbringe ich den Nachmittag mit Herumstromern durch die Staubkulturlandschaft von Alcatraz.
Da sind Mad-Max-Darsteller mit Achtzylindern und Sandbuggys, die sich die draufmontierten Flammenwerfer von ausschließlich männlichen Festivalbesuchern erklären lassen. Da wird bei vielen eher kleineren Bands niveaulos neben der Bühne Werbung für Arbeits- und Wanderbotten gemacht (»Run to the Hills« – höhöhö!). Da ist der Stand eines deutschen Merchandisehändlers, der Überraschungsnickis günstig verkloppt. Mein Sandkastenfreund kauft sich zwei davon, und es ist zweimal das gleiche Shirt der so beliebten wie gehassten Sleep Token, die nicht auf dem Alcatraz spielen. Ich mache Spiel, Spaß und Spannung mit, und in meinem Überraschungsei finde ich ein T-Shirt vom Splash!-Festival. Naja. Dafür ist die Frikandel so schmackhaft, dass man sich damit willfährig den Mundraum verbrennt.
Laut dem belgischen Onlinemagazin Metal Overload waren letztes Jahr allein am Festivalsamstag 20.000 Besucher gekommen. 25.000 sind dieses Jahr angepeilt. Das Alcatraz sei stetig am Wachsen, so einer der Holländer auf dem Campingplatz, auch wenn das dem Festival nicht immer guttue. Die Duschen seien schlechter, und man habe bei der Anreise gefürchtet, keinen Platz mehr fürs Zelt zu haben.
So knapp es wirklich auf dem Zeltplatz zugeht, bin ich doch von den Wasserklosetts beeindruckt und der Arbeit derjenigen, die, teils Absperrband zu Haarband umfunktioniert, mit Lappen und Bürste von einer benutzten Latrine zur nächsten flitzen, ehe man drauf darf. Ich wünsche, die Kolleginnen und Kollegen kriegen für diese Drecksarbeit mindestens einen Stundenlohn im Wert von zehn Coincolas, vermute aber eher den in Belgien derzeit gültigen Mindestlohn von 12,83 Euro.
Bauchladen und Ponyhof
Am frühen Abend dann spielt die perfekte Liveband: Dying Fetus sind ein dreiköpfiges Death-Uhrwerk aus Annapolis (USA). Ihm bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein Genuss, auch ohne weitgreifende diskographische Kenntnisse. Wenn ich sie bis dato auf Festivals habe spielen sehen, war es zwei, drei Uhr nachts, und man war dann leider sehr damit beschäftigt, Doppelfußgewitter zum Trotz nicht im Stehen einzuschlafen. Um so dankbarer bin ich dafür, dass sie einmal zu christlicher Zeit loslegen dürfen.
Danach Crystal Lake: Ein japanischer Bauchladen, wie mein Sandkastenfreund zutreffend feststellt, adressiert das Quintett aus Tokio doch vor manchem Song explizit, ob das jeweilige Machwerk nun dem Metalcore-, dem Deathcore- oder dem Hardcore-Enthusiasten die Ohren schmeicheln solle. Ich fürchte, der Gitarrist hat sich beim Animieren der Masse zum Armewerfen die Schulter ausgekugelt. Nicht jede Entscheidung im Leben ist richtig: Dafür haben wir den Rotterdamer Avantgardismus Dool verpasst und sollen verdammt sein.
Der Frust motiviert zur nächsten Fehlentscheidung: So sehr ich mich auf das Stockholmer Death-Metal-Brett Hypocrisy gefreut habe, so sehr geht das Zerebrum im Böllerstoff unter. »Swallow your freedom / Swallow your smile«: Peter Tägtgren schmeißt mir den bunten Strauß Verschwörungserzählungen grollend entgegen, aber ich kriege ihn nicht zu fassen und gehe statt dessen vorzeitig zur Hauptbühne, wo die Essener Kreator natürlich nicht tun, was ich mir wünsche, und einfach »Gods of Violence« (2017) in Gänze spielen. Das Leben ist kein Ponyhof.
Tags drauf sind sich alle einig, dass die Band des Freitag abends die Sludger Mastodon waren. Bunter Bühnentrip, sauber abgemischt – das sich grad mit Gründungsmitglied Brent Hinds* völlig verkrachte Projekt aus Atlanta (USA) wäre vielleicht auch mein Favorit, könnte ich mit deren Musik nur heute so viel anfangen wie zu Zeiten von »Once More ’Round the Sun« (2014). Vielleicht hat sich auch jW-Redakteur Michael Saager in mein Hirn geschlichen, der Mastodon dereinst zu Kitsch erklärte.
Am Samstag haben sich die Wolken verzogen, weswegen ich den Erfolgsfan mache und zu Drowning Pool erst dann gehe, wenn sie mit ihrem Hit »Bodies« abschließen. Ich bin mir sicher, mein kollabierter Body hätte bei der Hitze sonst den staubigen Floor vor der Hauptbühne gehittet. Dafür gehe ich etwas eher weg von Rivers of Nihil, deren aktuelles Self-Titled-Album mich weniger überzeugt hat als die Vorgängeralben. Grundsätzlich aber stärkt die technizistische Death-Combo aus Reading (USA) den Verdacht, dass das Saxophon viel zu selten im Metal Benutzung findet. Dazu weht ein laues Lüftchen unter dem Dach der »Helldorado«-Stage. Ein bisschen Ponyhof ist also doch.
Rivers of Nihil werden in ähnlich gutem Sound präsentiert wie die Progressiven von Between the Buried and Me (Raleigh, USA), ehe es mit Nailbomb grobkernig wird. »Point Blank« (1994) wird krachend gegeben, und mein Sandkastenfreund fragt mich, ob da irgendwas ausgefallen sei. Ich quäle mich auch, zumal von der Sonne attackiert, bis Igor Amadeus Cavalera, Max Cavaleras jüngster Sohn, von der entsprechend dekorierten Prison-Stage aus »Fuck every politician!« für einen im Ernst sagbaren Satz hält, während in Lack und Leder gewandete Wärterinnen die ersten Reihen des Publikums mit Wasserspritzpistolen erfrischen. So ulkig wie ein halber Sonnenstich.
Während der polnischen Urväter Vader (die Ansagerin: »The pioneers, the survivors, the destroyers!«) sitze ich zerstört im schattigen Eckchen der Swamp-Stage und überdenke mein weiteres Überleben. Zu Jedermanns guilty pleasure, der Hattinger Caliban, schaffe ich es dann doch. Ein alter Bandkollege meinte anno dazumal, das Prinzip jener Metalcoreband bestehe darin, immer genau das Falsche zu tun. Immer ist falsch: »The Opposite From Within« (2004) und »I Am Nemesis« (2014) sind herausragende Alben. Live kickt einen die Nostalgie darüber hinweg, dass Marc Görtz’ Gitarre im Intro von »Memorial« abschmiert und dass es zwar auf der Gefühls-, nicht aber auf der Leistungsebene sinnig ist, dass Rhythmusgitarrist Denis Schmidt die Clean Vocals der alten Lieder übernimmt anstelle des im letzten Jahr dazugestoßenen Bassisten Kenneth Duncan, der im Vergleich wirklich singen kann.
Perfektion dagegen: Das live Dying Fetus kaum nachstehende New Yorker Quintett Suffocation und Fit For a King. Der Messe letzterer mit der Fachrichtung christlicher Metalcore wohnen auch manche jubelnd und jauchzend bei, die von ihrem Rücken aus die frohe Botschaft verkünden: »Jesus is a cunt!« Gotteslästerlich: Für Fit For a King verpasse ich Doro Pesch.
Geschmackssachen
Abends das Highlight: Candlemass. Die schwedischen Doom-Legenden kommen mit himmlischem Sound daher, sind so unprätentiös und ehrlich dankbar dafür, nach über 40 Jahren immer noch spielen zu können, dass man sie von der Bühne weg knuddeln möchte. »Seltsam«, sagt Sänger Johan Längquist, »dass Doom Menschen glücklich macht.« Und dann geben Candlemass wieder den Beweis. Das späte Sahnehäubchen: Die Ikonen des Florida Death Metal Obituary, für die ich die Thrasher Whiplash (New Jersey, USA) einfach verpassen muss. Beseelt schlafe ich ein, Paleface Swiss aus der Dose nahe meiner Zeltwand kann mir nichts mehr anhaben.
Der letzte Festivaltag beginnt mit der Freude darüber, immer noch nicht im Krematorium zu liegen, obwohl mir Hintern und unterer Rücken mittlerweile so schmerzen, als hätten mir Whiplash ebensolchen verpasst, um sich für die Missachtung zu rächen. Erst jetzt fällt mir auf: Das in Deutschland exzessiv gewordene Flunky-Ball-Spiel gibt es hier überhaupt nicht. »Warum erfindet ihr Deutschen Spiele, um zu trinken? Warum setzt ihr euch nicht einfach an die Theke und trinkt?« fragt einer unserer niederländischen Nachbarn. Ich weiß es auch nicht.
Erste Band: Die hiesige Hardcore-Größe Congress. Das irokesenschnittige Kind mit Babyspeck vor mir hat »Fuck the USA« auf seinem Shirt stehen. (Es gibt übrigens exakt einen auf dem Festival mit »Make America Great Again«-Mütze, und er hat Patches von Amon Amarth und Five Finger Death Punch auf seiner Battle Vest. Vielleicht, denke ich, ist doch alles eine Geschmackssache. Aber das stimmt natürlich nicht.) Congress machen ihren Soundcheck selbst, danach geht einiges schief beim Heranziehen von Gastsängern. Trotzdem sieht man die H8000-Band hinterher zufrieden durch die Menge schlendern, und warum auch nicht?
Schwarze Schönheit
Danach das Highlight des Tages: Die portugiesische Postmodernisierung des Black Metal, Gaerea. Die Band aus Porto kommt von Scheitel bis Sohle in Schwarz auf die Bühne und gibt viel von ihrem dritten Album »Coma« (2024). Der Sound ist so elegant wie Rúben Freitas somnambul-fließende Posen als Nachtgespenst. Würde er dazwischen nicht mit dem Publikum interagieren, um Resonanz betteln und sich so selbst Zacken aus der Erlkönigkrone brechen, der Auftritt wäre perfekt.
Nichts kann die schwarze Schönheit aus Porto übertrumpfen an diesem Tag. Auch nicht die Antiakzelerationisten Fear Factory, die mit dem Sängerwechsel vor zwei Jahren zwar einen ähnlichen Rosenkrieg anzettelten wie jüngst Mastodon, der sich jedoch durchaus als gerechter herausstellt – der online gecastete Fanboy Milo Silvestro kann den Burton C. Bell besser als der Burton C. Bell dieser Tage selbst.
Der Auftritt von Emperor wird streckenweise von einem knarzenden Drummikro torpediert, was die norwegische Black-Metal-Kriegsmaschine von Vegard »Ihsaan« Tveitan und Co. zwar beschädigt, aber lange nicht lahmlegt. Den Auftritt von Slayer-Gitarrist Kerry King streife ich exakt so, dass ich erst von der Mainstage die »Alle Politiker sind Schweine!«-Message bekomme und dann bei Downset gleich noch mal, nur von Rapcore gerahmt. Also Merz, von der Leyen, Lula, Trump, Díaz-Canel, Netanjahu, Xi und alle je im Kortrijker Stadtrat Vertretenen ein und dasselbe? Na ja.
Mindestens so streitbar sind Machine Head, die den idealen Schlusspunkt des diesjährigen Alcatraz bilden. Warum? Die Groove-Metal-Band aus Oakland (USA) spiegelt mit all ihrem Großartigen und Furchtbaren das Festival monadisch. Alle haben ihre Meinung von Machine Head; und alle drücken sie aus: Der Typ neben mir in der Menge geht lange mit, bis Machine Head etwas von ihrem gelinde gesagt grässlichen neuen Album »Unatoned« anstimmen: Da setzt er sich postwendend auf den Boden und spielt Onlineschach. Die Teenager drei Meter weiter dagegen gehen ab wie Schmitz Katze.
Als Robb Flynn mal wieder zum Labern ansetzt und nach langem Monolog »Darkness Within« Ozzy Osbourne widmet, weint der Metalhead neben mir so bitterlich, dass ich angesteckt fast mitweine, wäre es nicht so belämmert, dass Flynn nicht aufhören kann, Melodien mitzudüdelidüüün, die er eigentlich mit seiner Gitarre fabrizieren söllte. Eine Affektiertheit, die nach großem Feuerwerk und Papiergirlandensalat zu »Halo« im Menschenstrom vorbei am Friedhof auf dem Weg zu den Zelten diesen und jene zur Parodie einlädt. Es sind die Gleichen, die kurz zuvor bei »Ten Ton Hammer« komplett ausgerastet sind. Es gibt auf der Welt keine Emotion, die Machine Head nicht auslösen kann.
Am Montag morgen verabschieden wir uns von unserer temporären Nachbarschaft. Nächstes Jahr wieder? Ich weiß nicht.* Während die Druckereimaschinen schon anlaufen, erreicht mich die Nachricht, dass Brent Hinds in der Nacht vom 20. August bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Der traurige Unfall ereignete sich in der Innenstadt von Atlanta, Hinds starb standesgemäß auf seiner Harley.
Ken Merten, Jahrgang 1990, ist Autor und Journalist und lebt in Leipzig. Zuletzt erschien von ihm an dieser Stelle in der Ausgabe vom 28./29 Dezember 2024 der Artikel »Appetit auf Würstchen«
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Victoire Mukenge/REUTERS01.08.2025
Victoire Mukenge/REUTERS01.08.2025USA: Abtreibungsgegner diktieren Politik
 Claudio Bresciani/TT/imago23.01.2025
Claudio Bresciani/TT/imago23.01.2025Sumpfdotterblume im Frost
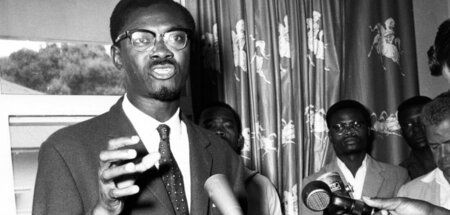 imago/Belga11.03.2024
imago/Belga11.03.2024Ende einer Hoffnung
Mehr aus: Wochenendbeilage
-
»Die Erfindung von Waffen ist ein evolutionärer Irrtum«
vom 23.08.2025 -
Die unsichtbare Faust
vom 23.08.2025 -
Das große Blubbern
vom 23.08.2025 -
Vermintes Terrain
vom 23.08.2025 -
Kreuzworträtsel
vom 23.08.2025
