Regie der Aufarbeitung
Von Jens Mehrle
Die erste deutsche Schule für Regisseure entstand 1974 in der DDR mit dem von Manfred Wekwerth und anderen gegründeten Institut für Schauspielregie. In Werner Heinitz’ »Dialog der Regisseure«, der zur Eröffnung des bat-Studiotheaters als Sitz des Instituts am 25. November 1975 von Schauspielern gelesen wurde, antwortet der russische Regisseur und Schauspieler Wsewolod Meyerhold auf die Frage eines Studenten nach dem Theater der Zukunft, das Gegenwartstheater werde sich nur dann günstig entwickeln, wenn es »die Aufgaben des Tages vom Standpunkt der Zukunft aus stellt«.
Insofern die Kunst des Inszenierens, eine – so Peter Hacks – »Erfindung des Imperialismus« war, die dort rasch wieder verfallen musste, konnte sie im Sozialismus fruchtbar beerbt werden und im Erproben von Weltentwürfen, in der Darstellung der Widersprüche menschlicher Emanzipation von eminenter Bedeutung für die neue Gesellschaftsform sein. Sie konnte aber auch, von gesellschaftlicher Praxis und neuer Dramatik getrennt, zurücksinken in die Konformität des Stadt- oder Nonkonformität des Regietheaters.
In die Zeit solcher Krise fiel die Gründung des Instituts. Seine Dozenten, Akteure des DDR-Theaters oder seiner Wissenschaft, kannten das Welttheater und waren bestrebt, die Theaterkunst und den Sozialismus in der DDR zu entwickeln, sahen das Institut nicht als Rückzugsort, sondern als Instrument und Basis für eingreifendes Handeln. Gerade seine relative Unabhängigkeit schien dafür günstig. Wekwerth spricht von einem »Lehr-, Arbeits- und Forschungsinstitut«. Wurde es diesem Konzept und seinen Zielen gerecht? Beförderte es kritisch-sozialistische Theaterkunst, hegte es sie ein, bildete es Regisseure oder Dissidenten? Und zeigte es sich in der Lage und gewillt, nach 1990 für den BRD-Theaterbetrieb auszubilden? Oder befähigte eine subversive marxistische Substanz, in den geänderten Verhältnissen neue Modi und Formen zu entwickeln, alte wiederzuentdecken, um als Kunst entgegnen zu können?
Das Jubiläum sei Anlass für »Rückblick, Positionsbestimmung und Ausblick, kritische Reflexion und Feier der Existenz«, hieß es vorab von der Regieabteilung – aber auch für diese Fragen? Der alles überlagernde Rückblick, der nur die 15 DDR-Jahre betraf, richtete sich nicht auf die Arbeit des Instituts, sondern suchte Material für die »Aufarbeitung der SED-Diktatur«, deren Grundlage der Antikommunismus ist, den bestätigt, wer sich an ihr beteiligt.
Als Hauptakt des Festprogramms am 24. Oktober präsentierten Regiestudenten ein Dokumentartheaterprojekt, in dem sie sich auf die Suche nach politisch motivierten Exmatrikulationen am einstigen Regieinstitut begeben hatten. Dozent Noam Brusilovsky betonte die Notwendigkeit einer Aufarbeitung, die lange gebremst worden sei. Die Studenten zeigten sich von den Begegnungen mit den Opfern betroffen. Der Text eines ehemaligen Studenten wurde verlesen, von dem unklar blieb, ob er Literatur, Spekulation oder Anklage war, die doch Raum für Gegenrede oder Prüfung erheischt hätte. Es fand aber auch kein juristischer Beweisführung enthobenes Theater statt, es sei denn, die vorbereiteten Wortmeldungen waren als Parodie inszeniert und gemeint. Oder war, was als »Dokumentartheater« angekündigt, nun als »Forschungsprojekt« firmierte, selbst ein ausgefallenes Stück und gehörte in die von Studenten der Humboldt-Universität erarbeitete Ausstellung im Foyer?
Deren Titel »Ausgefallene Stücke (un)mögliche Spielräume am bat-Studiotheater« definiert mit »Mauerbau« als ursachlosem Grauen und »friedliche Revolution« als Happyend einen Zeitraum, der weder für eine Darstellung der Arbeit des Regieinstituts, das ins bat eben erst 1975 einzog, noch für die Schauspielschule, die bereits vor 1961 Inszenierungen herausbrachte, zutrifft. Und im bat fanden viele der Fallbeispiele gar nicht statt. Diese Unstimmigkeiten von Zeit und Ort ordnet die Dramaturgie der Aufarbeitung, die in den Rahmen presst, was ihr zu passen scheint. Dennoch bleibt die Ausbeute mager.
Für das Regieinstitut fand sich eine Inszenierung, die abgesetzt wurde, weder wegen der politischen Brisanz des Stücks noch der Inszenierung, gleichwohl zum Schaden der Studentin, die 2003 nachträglich ihr Diplom erstritt. Sonst wird von einem gestrichenen Gedicht, einem Eingriff in die Maskengestaltung, einer Umlenkung eines Stücks an eine andere Bühne zwecks Nichtaufführung bei Honorierung des Autors berichtet.
In der Schauspielschule kam es zur einzigen Absetzung einer Inszenierung erst 1990 durch Studenten der Puppenspielabteilung selbst, was eine mutige Selbstbefreiung gewesen sei, während es in den 80er Jahren staatlich verursachte Missverständnisse zwischen der »Friedensaktivistin« und Regisseurin Freyer Klier und ihren Studenten gewesen seien, die eine Inszenierung in Schwerin scheitern ließen. Wir erfahren auch von einigen unrealisierten Plänen.
Die Zahl der Stücke, die seit 1990 an deutschen Theatern ausgefallen sind, weil es eine Anzahl Theater nicht mehr gibt, und jener, die aus politischer oder ästhetischer Opportunität abgesetzt wurden oder nicht einmal erwogen werden zu spielen, böte ein Gegenwartsmaß für derlei Betrachtung der Vergangenheit.
Dabei ist, das zeigen die schönen Exponate der Ausstellung auch, das Archiv reich. Gleichsam zwischen den Zeilen lassen sich Geschichten entdecken. Die Reihung von Einzelfällen unter dem Siegel der Aufarbeitung ohne ihre Erforschung im Zusammenhang jedoch fördert keine Erkenntnis, entspricht vielmehr der Willkür, die man der aufzuarbeitenden Epoche unterstellt.
Die in Feier und Ausstellung unternommenen Rückblicke reproduzieren Klischees und sind uninteressiert an Theater. Die Forschungen des Theaterwissenschaftlers und Dramaturgen Thomas Wieck, der die Regieausbildung lange mitgestaltete, lassen hoffen, die Geschichte des Regieinstituts in ihren kulturpolitischen und theaterhistorischen Kausalitäten genauer betrachten und verstehen zu können. Dass die Hochschule seine Ergebnisse anlässlich des Jubiläums gerade nicht publizierte, spricht nicht für ein Interesse an eigener Geschichte, sondern für ein Interesse an einer passenden Sicht. Die Studie sollte, als Buch gedruckt griffbereit in der Bibliothek der Hochschule stehen und nicht eine spätere Ausstellung ausgefallener Bücher der 2020er Jahre zieren. Denn wie Theater spielen und Stücke inszenieren ohne den »Standpunkt der Zukunft«, und wie lässt sich ein »Standpunkt der Zukunft« erwerben ohne die Kenntnis der Vergangenheit, zumal wenn in der Vergangenheit die Zukunft war?
»Was tun?! – 50 Jahre Regieausbildung« – Gespräch mit Studierenden und Lehrenden, Einführung: Thomas Wieck, 25. November, 20 Uhr, Kaffe, Immanuelkirchstr. 6, 10405 Berlin, Anmeldung: 030/68 32 13 90
»Ausgefallene Stücke (un)mögliche Spielräume am bat-Studiotheater«, HfS Ernst Busch, Foyer, Zinnowitzer Str. 11, 10115 Berlin, bis 20. Februar 2026
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
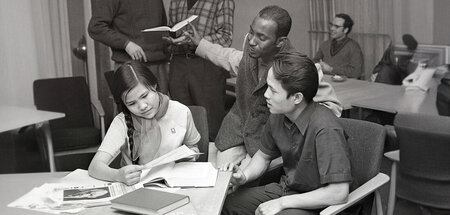 Wolfgang Schmidt/imago25.02.2025
Wolfgang Schmidt/imago25.02.2025Auf den Kopf gestellt
 Christian Thiel/imago29.06.2024
Christian Thiel/imago29.06.2024»Manchmal haben sich die alten Genossen fast totgelacht«
 CHRISTIANE EISLER / TRANSIT30.06.2012
CHRISTIANE EISLER / TRANSIT30.06.2012»Design ist an sich sozial «
Mehr aus: Feuilleton
-
Sand im Getriebe
vom 24.11.2025 -
Preiswert oder nicht
vom 24.11.2025 -
Was tät’ ich geben
vom 24.11.2025 -
Nachschlag: Sich davonstehlen
vom 24.11.2025 -
Vorschlag
vom 24.11.2025 -
Veranstaltungen
vom 24.11.2025
