Reim und Rache
Von Erich Hackl
Er sei, schreibt der Herausgeber Andreas F. Kelletat, bei der Lektüre von Juliette Parys Gedichten »An die Deutschen« erst einmal erschrocken: »So wortgewaltig und so voll von Verlangen nach Rache hatte noch niemand uns Deutsche angesprochen, noch niemand von jenen, die dem aus Hitlers Deutschland entfachten Völkermord entkommen waren.« Kelletats Reaktion ist aufgrund der vehementen Ankündigung verständlich: »Ihr braunen Nazis, / Braun zum Erbrechen, / Schwarzbraungelbblutig, / Ihr seid noch da! / Ich will Euch töten. / Wie mit den Taten, / So mit der Schrift.«
Allerdings könnte das Erschrecken auch dem Zweifel geschuldet sein, ob Parys balladenhafte Gebilde den ernsten Inhalt nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Die Schoah in Knittelversen, in denen sich Lust auf Brust und Gier auf Tier reimt! Sind sie lesenswert nur wegen der entwaffnenden Naivität ihrer Verfasserin, als historisches Dokument oder weil sie Adornos Diktum bestätigen, dass es barbarisch sei, nach Auschwitz – zu Auschwitz’ Zeiten genauer gesagt, denn ein Großteil der Texte ist schon 1944 entstanden – Gedichte zu schreiben? Soll man sie, kaum gelesen, gleich wieder vergessen, weil sie einen in ihrer formalen Unbedarftheit an die Gedichte der »schlesischen Nachtigall« Friederike Kempner erinnern, die ihre ernsten oder abwegigen Anliegen durch unfreiwillige Komik desavouiert hat? Kempner reimte, Heinrich Heine zu Ehren: »Ruh’ in Frieden, großer Dichter, / Ruh’ in Frieden, Dichtergeist, / Ruh’ in Frieden, Herz voll Saiten, / Das kein Misston mehr zerreißt«, und Pary repliziert ein halbes Jahrhundert später: »Noch einmal den Dichter Heine / Gott in mir hat aufgetan –/ Und ich knie hin und weine, / Wie der Werfel es getan.«
Der Rezensent ist kein Richter, eher ein Esel aus Buridans Herde, der bald belustigt, dann wieder fasziniert in den Gedichten liest und sich zwischen Zweifel, Zustimmung und Abneigung nicht entscheiden mag. Es stimmt, was Kelletat in seinem gehaltvollen Nachwort geschrieben hat: dass die 1903 in Odessa geborene Pary »das Grässliche grässlich« benannt habe. Dieses Urteil ist nicht nur deshalb zutreffend, weil sie die Judenmorde und sonstigen Verbrechen der »Nazihorden« drastisch schildert, sondern weil die heftige Gefühlsbewegung, in der sie das tut, die Aneignung einer tradierten, als Inbegriff deutscher Feinsinnigkeit erkannten Lyrikform zu erzwingen scheint: »Es wird mir schwer und schreckhaft süß, / Es ist für mich ein Fluch, / Dass ich in dem verfluchten Deutsch / Gedichte schreiben muss. / Bin auferstanden aus dem Volk, / Das Ihr erschlagen habt, / Um Euch zu sagen, dass es nie / Eine Judenfrage gab. / Die jüdische Frag ist nur ein Teil, / Wie die deutsche Frage auch, / Von der einen Frage, die man stellt / An die Menschheit überhaupt. / Von der einzigen großen Frag, / Ob die Menschheit nicht verreckt, / Ob sie nicht einmal für allemal / Versinkt in Blut und Dreck.«
Egal, wie nahe uns diese beunruhigend aktuellen Verse gehen – ein Gewinn, dazu das Einlösen einer historischen Verpflichtung, ist es allemal, sie lesen zu dürfen. Die Erstausgabe war Ende 1946 in einem französischen Verlag erschienen und hatte kein deutsches, kaum ein deutschsprachiges Publikum gefunden. Außerdem macht einen das Nachwort, das ein Drittel des Buchumfangs ausmacht, mit dem bewegten Leben der Autorin bekannt. Juliette Pary hieß eigentlich Julia Gourfinkel, stammte aus einem kulturbegeisterten assimilierten Elternhaus und verließ Mitte der 1920er Jahre gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Nina die Sowjetunion. In Paris arbeitete die Sprachenkundige – sie beherrschte außer Russisch und Französisch Deutsch und Englisch – als literarische Übersetzerin, veröffentlichte drei Romane sowie zahlreiche Reportagen, aus denen ihr Einsatz für Heimkinder und straffällig gewordene Jugendliche hervorgeht, und heiratete 1931 den ebenfalls in Russland geborenen Zionisten Isaac Pougatsch, mit dem sie nach ihrer Flucht in die unbesetzte Zone Frankreichs ein Heim für jüdische Kinder leitete, ehe die beiden mit dem Auftrag, sich auch dort um Flüchtlingskinder zu kümmern, von der Leitung des Kinderhilfswerks OSE in die Schweiz geschickt wurden. Im Spätsommer 1944 kehrte Pary, mittlerweile von Pougatsch getrennt, ins befreite Paris zurück, wo sie ihr reformpädagogisches Wirken fortsetzte. Sechs Jahre später sollte sie unter ungeklärten Umständen – Freitod oder Unfall – im Genfer See ertrinken.
Es ist ein Glücksfall, dass Andreas F. Kelletat sich der Gedichte und des Lebens Juliette Parys angenommen hat. Der Translationswissenschaftler war zufällig – im Zuge seiner Suche nach französischen Übersetzern deutscher Literatur – auf ihren Namen gestoßen. Nun wollte er sie auch als Autorin kennenlernen und ihre wechselhafte Biographie erforschen. Kelletat stellt sich, schreibend, nie in den Vordergrund, aber seine Überlegungen und Beobachtungen sind meistens bedenkenswert. So, wenn er sich daran erinnert, dass es während seiner Schulzeit in den späten sechziger, frühen siebziger Jahren »als ein Zeichen von Antisemitismus und somit von Rassismus« angesehen wurde, jemanden als Juden zu bezeichnen. Religionszugehörigkeit galt als Privatsache. Erst später, als Erwachsenem, sei ihm klargeworden, »dass sich die Vorstellung von dem Jüdischen als Konfession zwar in Folge von Aufklärung und französischer Revolution in weiten Teilen Westeuropas verbreitet und zur Emanzipation und Assimilation geführt hatte, so dass aus ›Juden in Deutschland‹ ›deutsche Juden‹ wurden, dass das in weiten Teilen Osteuropas aber anders aussah. Dort konnte man nicht Pole und Jude oder Jude und Russe sein.«
Bemerkenswert ist auch sein diskreter Hinweis, in der Besprechung von Parys »Image du jeune Israël« (1950), auf die Leerstellen in diesem Reisebericht: »Im Negev sah sie vereinzelt Araber und Beduinen. Ansonsten kommen in ihrem Israel-Buch Araber nur vor, wenn von verlassenen Dörfern die Rede ist. Warum und wohin die einheimische Bevölkerung aus diesen palästinensischen Orten verschwunden war, wurde von Pary nicht berichtet.«
Juliette Pary: An die Deutschen. Gedichte. Hrsg. und mit einem Nachwort von Andreas F. Kelletat. Persona-Verlag, Mannheim 2025, 136 Seiten, 18 Euro
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
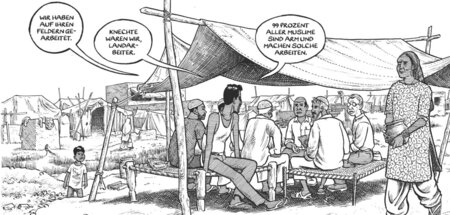 Reprodukt15.10.2025
Reprodukt15.10.2025An die Sterne genagelt
 Michael Polster05.03.2025
Michael Polster05.03.2025Dem Dichter eine Gasse
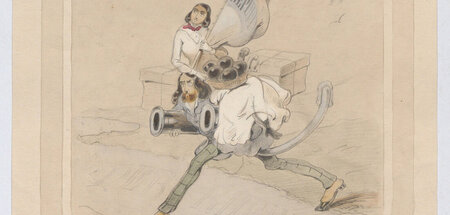 IMAGO/piemags09.03.2023
IMAGO/piemags09.03.2023»Donnern will ich durch die Lande«
Regio:
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Totenkopf mit Strohhut
vom 20.11.2025 -
Vorschlag
vom 20.11.2025 -
Risse in der Gegenwart
vom 20.11.2025 -
Wimmelbild des Wahns
vom 20.11.2025 -
Die Axt im Haus
vom 20.11.2025
