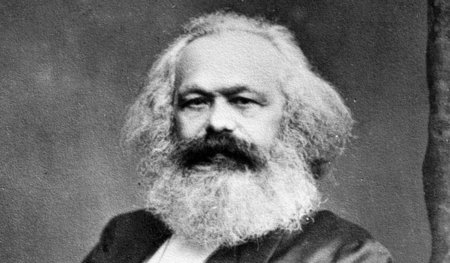Widerspruch und Dialektik

In diesen Tagen erscheint das Heft Nummer 329 der Zeitschrift Das Argument unter dem Titel »Marx 200 und Achtundsechzig 50« mit Beiträgen von Peter Jehle, Frigga Haug, Klaus Weber und vielen anderen. Wir veröffentlichen daraus mit freundlicher Genehmigung der Herausgeber den Beitrag von Wolfgang Fritz Haug »Widersprüche des Marxismus« – leicht gekürzt und unter Weglassung weiterführender Fußnoten. Das aktuelle Heft kann bestellt werden unter: www.argument.de (jW)
Seit der Frühzeit des Marxismus ist immer wieder gefordert worden, diesen seinen eigenen Grundsätzen entsprechend zu begreifen. Im folgenden werde ich diesem Anspruch dadurch zu genügen versuchen, dass ich den Marxismus von dem Standpunkt aus begreife, den Marx seine »dialektische Methode« nannte.
Bereits Henri Lefebvre hatte dazu angesetzt, »die lebendigen und gelebten Widersprüche, d. h. die Dialektik« des Marxistseins zu denken, und Adam Schaff mahnte 1978, diese Dialektik werde »leider zumeist ignoriert«. Aber wie ist sie zu verstehen? Es kann hier nicht um einen einseitig deterministischen Ansatz gehen, denn die geschichtsmaterialistisch verstandene Determination wirkt nie unvermittelt. Sie resultiert aus der Wechselwirkung von weltverändernder Praxis mit der zu verändernden Wirklichkeit. Dieses Verhältnis ist ein gleichsam polemisches, eines der Gegensätze und kann, »wie alles, was mit Konflikt, Zusammenstoß, Kampf zusammenhängt, ohne materialistische Dialektik keinesfalls behandelt werden« – so hat es der marxistische Dichter-Philosoph Bertolt Brecht 1956, ein halbes Jahr vor seinem Tode, notiert. Mit diesem Gedanken stand Brecht nicht allein. Auf eine Umfrage aus dem Vorjahr, 1955, antwortete er: »Die Lektüre, die im vergangenen Jahr den stärksten Eindruck auf mich gemacht hat, ist Mao Tse-tungs Schrift ›Über den Widerspruch‹.« Mao eröffnet diese Schrift mit der These: »Das Gesetz des Widerspruchs, der den Dingen innewohnt, oder das Gesetz der Einheit der Gegensätze, ist das fundamentalste Gesetz der materialistischen Dialektik.«¹
Vorklärungen
In meinem Beitrag will ich zeigen, dass dieser Satz auch für die Bewegungsformen des Marxismus in seiner Geschichte Gültigkeit hat. Dazu sind zwei Vorklärungen nötig, eine zum Begriff des Widerspruchs und eine zweite zum Begriff der Dialektik. Was Widersprüche betrifft, so halten viele sie für etwas zu Vermeidendes. Und sie haben recht, wenn sie damit meinen, bei Erklärungen und Handlungen Konsistenz, also Widerspruchsfreiheit, anzustreben. Wenn Marx von Widersprüchen redet, meint er jedoch reale, objektive Widersprüche. Diese sind mit Kants Begriff des »Realgegensatzes« vergleichbar. Das einfachste Beispiel bietet die Ware. Sie ist einerseits Gebrauchswert als konkreter Reichtum, andererseits aber, und dominant, ist sie Wert als abstrakter Reichtum, Geld in spe, in dem vom konkreten Reichtum abstrahiert ist. Ihrer Produktion liegt gesellschaftliche Arbeitsteilung zugrunde, zugleich erfolgt sie ungesellschaftlich. Anders gesagt, der Warenproduzent produziert für die Gesellschaft, aber wirtschaftet in die eigene Tasche. Diese und andere Eigentümlichkeiten fasst Marx in dem Satz zusammen, »dass der Austauschprozess der Waren widersprechende und einander ausschließende Beziehungen einschließt. Die Entwicklung der Ware hebt diese Widersprüche nicht auf, schafft aber die Form, worin sie sich bewegen können. Dies ist überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche Widersprüche lösen.«²
Über diese Widersprüche muss jedoch selbstverständlich in logisch konsistenter, d. h. widerspruchsfreier Weise gesprochen werden. Die Doppeldeutigkeit des Wortes Widerspruch, dass es sowohl auf die Logik von Aussagen als auch auf die Struktur der ausgesagten Gegenstände sich beziehen kann, kommentiert Marx: »Dass das Paradoxon der Wirklichkeit sich auch in Sprachparadoxen ausdrückt, die dem common sense widersprechen, dem what vulgarians mean and believe to talk of, versteht sich von selbst. Die Widersprüche, die daraus hervorgehn, dass auf Grundlage der Warenproduktion Privatarbeit sich als allgemeine gesellschaftliche darstellt, dass die Verhältnisse der Personen als Verhältnisse von Dingen und [als; WFH] Dinge sich darstellen – diese Widersprüche liegen in der Sache, nicht in dem sprachlichen Ausdruck der Sache.« (MEW 26.3, 134)
Der wirkliche Widerspruch lässt sich begreifen als die Einheit von Einheit und gegensätzlicher Spaltung. Nun mag man denken, es ist für Marx eben der Kapitalismus von Widersprüchen heimgesucht, und die Überwindung des Kapitalismus löst alle Widersprüche auf. Doch dann wäre nicht einzusehen, warum Marx im »Hegelschen ›Widerspruch‹« die »Springquelle aller Dialektik« sieht (MEW 23, 623, Fn. 41), die es nur aus der idealistischen Form in die geschichtsmaterialistische zu übersetzen gelte. Im Sinne dieser Übersetzung traf Mao die marxsche Auffassung genau, als er Widersprüche in allen Dingen und Erscheinungen annahm.
Widersprüche sind jedoch nicht nur unvermeidlich wie eine ontologische Grundgegebenheit, sondern wirken auch als Motoren der Entwicklung. Vor Gericht, sagt Rosa Luxemburg, gilt der einzelne als überführt, wenn er sich in Widersprüche verwickelt, »die menschliche Gesellschaft im ganzen aber verwickelt sich fortwährend in Widersprüche, sie geht aber daran nicht zugrunde, sondern tritt umgekehrt erst dann in Bewegung, wo sie in Widersprüchen steckt«. Zur Bekräftigung lässt sie Hegel sagen: »Der Widerspruch ist das Fortleitende.«³
Diesem Bewegungsantrieb, der ebenso schöpferisch wie zerstörerisch ausfallen kann, kommt eine Schlüsselrolle zu. Die Frage nach ihr führt zur zweiten Vorklärung. Sie betrifft den Begriff der Dialektik. Vorstellungen wie die, man könne die Hegelsche Dialektik einfach »umstülpen«, weil sie bei ihm »auf dem Kopf steht«, führen in die Irre. Denn während Marx zwar die idealistische, Hegelsche Dialektik »auf die Füße gestellt« hat, kann dieser Akt doch nicht als einfache Umkehrung begriffen werden. Die Übertragung hegelscher Denkformen auf geschichtsmaterialistischen Boden verlangt ihre Rekonstruktion von Grund auf, wobei »die Textur auseinandergenommen und nach einem völlig anderen ›Algorithmus‹ zusammengesetzt werden« muss.⁴ Meine jahrzehntelangen Untersuchungen zur marxschen Praktizierung der Dialektik im »Kapital« und die dabei gemachte Beobachtung, dass und wie Marx die Widersprüche und die Übergänge zu ihren Bewegungsformen durch Analyse der Praxis entwickelt, haben mich dazu geführt, sie als Dialektik der Praxis zu charakterisieren. Praxis meint hier das Verhalten in bestimmten Verhältnissen, die ihm seine Bedingungen vorgeben und die es modifiziert. Im Anschluss daran lässt sich zwischen theoretischer Dialektik und praktischer Dialektik unterscheiden. Sie bezieht sich auf menschliches Handeln, gerade auch auf organisiertes Handeln, unter dem Gesichtspunkt des Umgangs mit Widersprüchen oder der »Eingriffe in ein widersprüchliches Feld«.⁵ Hier kommt eine radikale Zweideutigkeit der Widersprüche in den Blick: Sie sind Gefahr und Chance in einem. Sie bedrohen die durch Organisation erreichbare Handlungsfähigkeit, während sie zugleich den Moment des möglichen Sprunges auf ein höheres Niveau anzeigen.
Operieren mit Antinomien
Eine Notiz Bertolt Brechts aus dem Jahre 1932 mündet in den Satz: Damit die Gegensätze nicht die Organisation spalten, »ist Operierenkönnen mit Antinomien nötig«.⁶ »Operierenkönnen mit Antimonien« bedeutet hier konkret, dass die kommunistische Partei, um nicht von Widersprüchen zerrissen zu werden, auch einander ausschließende Interessen verschiedener Sektoren ihrer Klassenbasis berücksichtigen muss (1932 vor allem Arbeitende vs. Arbeitslose). In diesem Sinn können wir im Rahmen der praktischen Dialektik zwischen aktiver Dialektik und passiver Dialektik unterscheiden. Die aktive Dialektik lässt sich mit der Kunst des Wellenreitens vergleichen, die passive mit dem Überrollt-Werden von der Welle. Für eine politische Führung, die immer neu eine Einheit von Unterschieden und zum Teil auch von Gegensätzen herstellen muss, kann die Kunst der aktiven Dialektik zur Überlebensfrage werden.
Formt die praktische Dialektik ihre Begriffe im Blick auf Widersprüche, mit denen weltverändernde Praxis zu rechnen hat, so ist ihr Ernstfall eine konkrete Situation, die Ziele und Wege, Zwecke und Mittel in einen unvermeidlichen Gegensatz bringt. Praktisch geht es um die Stärkung der Fähigkeit, aktuelle oder potentielle Krisenerscheinungen in der Perspektive ihrer möglichen Abwendung oder sogar ihrer Nutzung als Anstoß für Erneuerung wahrzunehmen.
Der Nutzen unserer Fragestellung für das marxistische Selbstverständnis erschließt sich, wenn man sich klarmacht, dass die Nachzeichnung der »Windungen und Wendungen«, der »Zickzackwege« des internationalen marxistischen Sozialismus sich in Millionen Details verlieren würde. Um dies zu verhindern, lenkt sie die Aufmerksamkeit auf die strukturellen Widersprüche des marxistischen Projekts, seine internen ebenso wie die äußeren, in seinem Verhältnis zu seinem gesellschaftlichen Umfeld sich ergebenden. Die internen Widersprüche des marxistischen Projekts lassen sich als Determinanten langer Dauer fassen, die in den wechselnden Konjunkturen in unterschiedlicher Weise virulent werden. Im Folgenden versuche ich, Aspekte einer Dialektik des Marxismus auf der Spur seiner konstitutiven Widersprüche zu skizzieren.
Der Weg von der marxschen Theoriebildung bis zur tatsächlichen geschichtlichen Geburt des Marxismus umfasst beinahe ein halbes Jahrhundert. Die Möglichkeit blitzt auf in den Monaten vor der bürgerlich-demokratischen 1848er Revolution in Gestalt des »Manifests der kommunistischen Partei«, das Marx 1847 im Auftrag eines kleinen, in London gegründeten Geheimbunds, des »Bundes der Kommunisten«, verfasste. Doch diese Schrift, bis heute eine der am weitesten verbreiteten auf der Welt, verschwand für ein Vierteljahrhundert in der Vergessenheit. Der zweite Moment, nun schon mit geballtem geschichtlichen Potential, ereignete sich siebzehn Jahre später. Marx formulierte die Inauguraladresse, mit der die Internationale Arbeiter-Assoziation (IAA), später bekannt als Erste Internationale, sich mit einem Paukenschlag auf der geschichtlichen Bühne zu Wort meldete. Dies ist der Geburtsmoment der modernen Arbeiterbewegung, noch nicht des Marxismus.
Philosophie der Praxis
Die marxsche Theorie bildet sich aus der Kritik zeitgenössischer Konzeptionen und der in diesen weiterwirkenden historischen Traditionen. Für die Rezeption der marxschen Theorien durch die späteren Marxisten ergibt sich daraus ein Widerspruch, der, solange er unbemerkt wirkt, eine passive Dialektik in Gang setzt und die Schüler von Marx hinter Marx zurückwirft. Kritik ist antithetisch, und die These, der sie sich entgegensetzt ist die des Gegners. Der erste, der auf das Problem hingewiesen hat, ist Antonio Labriola. Er macht es an Engels’ »Anti-Dühring« fest. Dieses Buch entwickle »keine Thesen, es ist vielmehr antithetisch«. Was dabei verloren zu gehen droht, nennt Labriola die »Philosophie der Praxis«, das »Mark des historischen Materialismus«.⁷ Antonio Gramsci wird an diese Einsicht anknüpfen. Unter seinen Zeitgenossen ist es wiederum Brecht, der verstanden hat, was es ferner heißt, dass »die Einwände, die wir den Behauptungen unserer mächtigen Gegner entgegenstellen müssen, aus dem gegnerischen Wort- und Begriffsmaterial zu formulieren sind« (GA 21, 585). Wenn Marx beispielsweise sagt: »Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt« (MEW 13, 9), so ist dieser Gegen-Satz als Antithese von der These bestimmt, die er negiert. Daraus die Lehre zu machen, »das Sein determiniert das Bewusstsein«, bedeutet einen Rückfall in vormarxistische Metaphysik, denn es negiert unwillentlich genau das, worum es marxistisch geht, nämlich die weltverändernde Praxis.
Der unerkannte Widerspruch erwischt die Marxisten gleichsam auf dem falschen Bein. Die Geschichte des Wortes »Marxist« führt auf den Gegensatz zwischen der marxschen Theorie-Praxis und den im Umfeld der entstehenden Arbeiterbewegung aktiven Gruppierungen. »Marxist« war ein Schimpfwort, das die Gegner von Marx in der Ersten Internationale gegen dessen Anhänger richteten, bis diese einige Jahre später daraus einen Ehrennamen machten. Bei der Gründung der Zweiten Internationale, sechs Jahre nach dem Tode von Marx, bekannten sich alle dort vertretenen politischen Organisationen der Arbeiterbewegung zum Marxismus. »Sie werden darüber verrückt werden, dass sie uns diesen Namen gegeben haben!« schrieb Engels (MEW 37, 235).
Die Fusion einer wissenschaftlichen Theorie mit einer proletarischen Bewegung gebar den Marxismus als lebendigen Widerspruch. Auf diesen Widerspruch war der Marxismus nicht theoretisch vorbereitet, denn er verfügte im Verständnis der Arbeiterklasse über keinen Begriff für sein unabdingbares intellektuelles – weil wissenschaftliches – Element. Dieser unreflektierte Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Selbstverständnis hat ebensoviel Schaden angerichtet wie das Fehlen einer marxistischen Theorie der Führung. Beides erarbeitete erst Antonio Gramsci in faschistischer Haft Anfang der 1930er Jahre, aber seine Texte kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Tragen, weithin sogar erst nach dem Untergang des europäischen Staatssozialismus.
Ein dritter Widerspruch ergab sich aus der Wechselwirkung des Marxismus mit seiner Umwelt. Die Marxsche Kapitalismustheorie verfügte, so großartig sie die allgemeinen Widersprüche des Kapitalismus und deren Bewegungsformen herausarbeitete, noch über keinen Begriff davon, wie ihr eigenes Praktisch-Werden den Kapitalismus verändern würde. Die dadurch mitbedingte historische Materialität einer sich schnell verwandelnden Welt entfernte die klassischen Texte des historischen Materialismus immer weiter von der aktuellen Realität. Die Revolution von 1917 potenzierte diese Distanz, da ihre Bedingungen den Marxschen Annahmen diametral entgegengesetzt waren. Gramsci nannte sie daher »Revolution gegen das ›Kapital‹«, nämlich im Widerspruch zur Marxschen Theorie. Dass Lenin sich dieser Distanz völlig bewusst ist, zeigt sein Vorwurf an Bela Kun, die Politik der Komintern zu kritisieren »auf Grund von Zitaten aus Marx, die sich auf eine der jetzigen ganz unähnliche Situation beziehen«.⁸ Dagegen bezeichnet Lenin nun »die konkrete Analyse einer konkreten Situation« als »die lebendige Seele des Marxismus«. Sie hat in jeder Epoche die Strategie der Arbeiterbewegung neu zu bestimmen. Auch der Umgang mit diesem Widerspruch kann zur Gefahr werden, wenn bei Stalin unter der »Vorherrschaft des Taktischen vor dem Theoretisch-Prinzipiellen« letzteres »zu einer Garnierung, einem Überbau, einer Verschönerung absinkt«, was den Niedergang beider besiegelte. So begriff es der späte Lukács.⁹
Bereits der Zusammenschluss von wissenschaftlicher Theorie und Proletariat hatte den praktizierten Marxismus in Gegensatz zum theoretischen gebracht. Rosa Luxemburg hat dies als Rache der »von Marx theoretisch aufgedeckten sozialen Daseinsbedingungen des Proletariats in der heutigen Gesellschaft an den Schicksalen der Marxschen Theorie selbst« bezeichnet (GW 1, 368). Es waren aber die Erfolge, die den Marxismus Ende des 19. Jahrhunderts in seine erste große Krise stürzten, als der Gegensatz zwischen (tatsächlich erreichter) Reform und (ausbleibender) Revolution virulent wurde. In die Politik brechen derartige Widersprüche als Gegensatz zwischen Nahzielen und Fernziel ein. Luxemburg, die in ihrer Polemik gegen Bernstein 1899 diesen Widerspruch eher unreflektiert ausgetragen hatte, insistierte vier Jahre später auf der Notwendigkeit, die auseinanderstrebenden Pole auf eine Weise zusammenzuhalten, die der Realpolitik gibt, was der Realpolitik ist, aber das pragmatisch Nötige auf die Realpolitik hinaustreibenden Ziele hin auszurichten. Sie orientiert auf »revolutionäre Realpolitik«, um den »spannungsreichen Vermittlungszusammenhang zwischen Nah- und Fernziel« aufrechtzuerhalten und zu verhindern, dass die Partei inmitten der Erfolge in der Sozialpolitik ihre Identität verliert. Diese »Spannung zwischen Weg und Ziel«, dem jeweiligen Tag und einer letztlich ungewissen Zukunft, durchzieht die Geschichte des Marxismus.¹⁰
Chancen des Gelingens
Widersprüche dürfen nicht mit Fehlern verwechselt werden. Fehler ereignen sich im Behandeln von Widersprüchen. Wenn es, wie Mao sagt, »keine Dinge [gibt], die nicht Widersprüche in sich trügen« (ÜdW, 371), ist das Operierenkönnen mit Widersprüchen eine Bedingung für politisches Gelingen. Widersprüche sind zu fürchten, aber lediglich wie eine Probe, die man bestehen muss, um nicht unterzugehen. Wenn die Widersprüche aufgestauten Veränderungsbedarf anzeigen, stellt die Gefahr zugleich eine Chance dar. Darum gilt die Maxime, die Bertolt Brecht seinem Dreigroschen-Roman voranstellt, nicht nur im Blick auf die Widersprüche der Gegner des Marxismus, sondern auch für diesen selbst: »Die Widersprüche sind die Hoffnungen!« (GA 21, 139) Doch freilich ist die bloße Hoffnung »nur eine unbeständige Lust«, wie Spinoza sagt, weil wir »über den Ausgang in gewisser Hinsicht in Zweifel sind«.
Wenn die Kunst des Wellenreitens einen lehrt, zur Spitze zu gelangen, ohne von den stets bedrohlich lauernden Widersprüchen herabgerissen zu werden, dann sind Antinomien, im antiken Sinne des Gehorsams gegenüber zwei gleichermaßen bindenden, jedoch einander ausschließenden Normen, widersprüchliche Wellen, die nicht geritten werden können, sondern uns nur herabreißen können. An Antinomien zu zerbrechen, ist das Thema, das dem politischen Drama der griechischen Antike seinen Charakter der Tragödie aufgeprägt hat. Ein vieldiskutiertes Beispiel bietet die Antigone des Sophokles. Antigones Bruder, Polyneikes, hat gegen Kreon, den Herrscher Thebens, sein Schwert erhoben. Er wird besiegt und getötet, die Bestattung seines Leichnams untersagt. Nun machen sich zwei gleichermaßen unantastbare Sittengesetze geltend: Das Staatsgesetz, verkörpert durch den Herrscher, verbietet die Bestattung des Aufrührers nach den Regeln des Kultes. Das kultische Sittengesetz aber verlangt von der Schwester des Toten in gleicher Unbedingtheit die Bestattung. Indem sie diesem Gebot gehorcht, verstößt Antigone gegen das staatliche Verbot und wird »lebendig eingemauert«. Nun zeugt die unversöhnte Antinomie Katastrophe um Katastrophe. Antigone begeht Selbstmord. Ihr folgt ihr Verlobter Haimon, der Sohn des Herrschers, in den Tod, diesem wiederum seine Mutter, Eurydike, die Gattin des Herrschers.
Die Logik des Operierenkönnens mit Antinomien, die ansonsten Katastrophen nach sich ziehen, wird von Aischylos dem Herakles bei der Befreiung des Prometheus zugeschrieben. Prometheus, für den jungen Marx »der vornehmste Heilige und Märtyrer im philosophischen Kalender«, war lebenslänglich an einen Felsen des Kaukasus »angekettet«. Das war die Strafe dafür, dass er gegen das Verbot des Herrschers der Götter, Zeus, verstoßen und die Menschen im Umgang mit dem Feuer unterrichtet hatte, was der Entwicklung ihrer Kultur zu einem Großen Sprung verhalf. Aischylos zufolge weiß Prometheus, dass Zeus und mit ihm die ganze herrschende Ordnung untergehen werden. Auf Zeus’ Frage, wer diesen Untergang bewirken werde, lässt er den Gefesselten antworten: »Er selbst sich selber, weil die Torheit ihn berät.«
Vorschein
Den doppelten Bann bricht Herakles. Er befreit Prometheus auf Schelmenweise, die das Urteil des Herrschers Zeus buchstabengetreu respektiert und dennoch zugleich nicht nur den Gefesselten befreit, sondern auch die herrschende Ordnung und Zeus selbst vor dem Untergang bewahrt: Prometheus muss für alle Zeiten einen Ring tragen, in den ein Stück des kaukasischen Felsens eingelassen ist. Der marxistische deutsch-schwedische Schriftsteller Peter Weiss hat sich in seinem großen, dreibändigen Jahrhundertroman »Die Ästhetik des Widerstands« die herakleische Aufgabe gestellt, eine Erzählweise für die Antinomien des Marxismus im 20. Jahrhundert zu schaffen. Sie macht den Eindruck, er befolge auf literarische Weise Brechts Maxime des Operierenkönnens mit Antinomien, obgleich er sie nicht kennen konnte, da sie erst zehn Jahre nach seinem Tode – er starb bereits 1982, kurz nach Fertigstellung seines Werkes – publiziert worden ist. Peter Weiss lässt historische Exponenten der zerreißenden Gegensätze des damaligen Marxismus auf eine Weise zu Wort kommen, die in ihnen die unaufhebbaren Antinomien respektiert. Dabei taucht der Vorschein eines künftigen Marxismus auf, der gelernt hat, seinen Widersprüchen nicht nur die Stirn zu bieten, sondern ihnen ins Auge zu blicken. Klaus Holzkamp, der Begründer der marxistischen Kritischen Psychologie, hat 1983, in Anspielung an eine berühmte Formulierung von Marx gesagt: »Die Vorgeschichte des Marxismus ist noch nicht zu Ende.«¹¹ Hier nun scheint die Geschichte des Marxismus als die des befreiten Prometheus auf – wenngleich nur als literarisch-imaginäre Antizipation und im Gedenken an so viele Opfer.
Anmerkungen
1 Mao Tse-tung: Über den Widerspruch in: Ausgewählte Werke, Bd. I, Peking 1968, 365–408 (zitiert als ÜdW)
2 Karl Marx u. Friedrich Egels: Marx-Engels Werke, Bd. 1–42, Berlin 1957 ff., hier Bd. 23, S. 118 (zitiert als MEW)
3 Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke, 5 Bde., Berlin 1970–1975, hier Bd. 5, S. 719 (zitiert als GW)
4 Wolfgang Fritz Haug: Marx’ Lernprozess. Von den Grundrissen bis zu Marx’ französischer Übersetzung von Kapital I«. In: ders.: Dreizehn Versuche, marxistisches Denken zu erneuern, Hamburg 2005, S. 223–235, hier S. 227
5 Wolfgang Fritz Haug: Für praktische Dialektik, S. 23. In: Das Argument 274, 50. Jg., 2008, H. 1, S. 21–32
6 Bertolt Brecht: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Frankfurt am Main 1989 ff., hier Bd. 21, S. 579 (zitiert als GA)
7 Antonio Labriola: Unterhaltungen über Sozialismus und Philosophie (1898). In: ders.: Drei Versuche zur materialistischen Geschichtsauffassung, hg. v. Wolfgang Fritz Haug, Berlin 2018, S. 172–280, hier S. 202 und 206
8 Wladimir Iljitsch Lenin: Werke, Bd. 31, Berlin 1953, S. 154
9 Georg Lukács: Gespräche mit Hans Heinz Holz, Leo Kofler und Wolfgang Abendroth (1966), Werke, Bd. 18, Bielefeld 2009, S. 349 f.
10 Frigga Haug: Revolutionäre Realpolitik. In: dies.: Rosa Luxemburg und die Kunst der Politik, Hamburg 2007, 57–94, hier S. 62
11 Klaus Holzkamp: »Aktualisierung« oder Aktualität des Marxismus? In: Aktualisierung Marx’, Argument-Sonderband 100, Berlin 1983, S. 53–64, hier S. 64