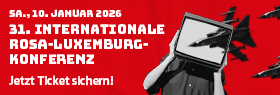Das große Umgruppieren
Von Reinhard Lauterbach
Bis zum Jahresende sollen russische Hyperschallraketen in Belarus stationiert werden. Dies kündigten die Präsidenten beider Länder, Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, Anfang dieses Monats bei einem Treffen auf der Insel Walaam im Ladogasee an. Putin sagte, nach dem Testeinsatz einer »Oreschnik«-Rakete gegen die ukrainische Raketenfabrik Piwdenmasch in Dnipro im vergangenen November sei jetzt die Serienproduktion dieser Systeme angelaufen. Sie würden parallel den russischen Streitkräften zugeführt und auch in Belarus stationiert. Die Standorte seien schon festgelegt, so beide Politiker.
Ob mit der Stationierung dieser mit Fluggeschwindigkeiten bis zu Mach 12 extrem schnellen Raketen mit jeweils bis zu sechs Sprengköpfen in Belarus auch verbunden ist, dass sie in das Eigentum der Regierung in Minsk übergehen, wurde nicht öffentlich mitgeteilt. Die Stationierung solle »dem Schutz des russisch-belarussischen Unionsstaates« dienen, so Alexander Lukaschenko, der sein Land 2024 als Stützpunkt für diese Raketen angeboten hatte. Wobei es offen ist, ob die Idee dazu Lukaschenkos Initiative war oder sich Putin gern »bitten ließ«.
Kurze Vorwarnzeit
Welcher strategische Nutzen von einer solchen Stationierung ausgehen soll, ist unter Experten umstritten. Für eine solche Vorwärtsstationierung in der mutmaßlichen Hauptverteidigungsrichtung spricht nach Aussagen in verschiedenen militärischen Fachpublikationen, dass die Flug- und damit die Vorwarnzeit für den potentiellen Gegner sich damit verkürzt. So wurde angegeben, dass eine »Oreschnik«-Rakete aus der Region Brest im Westen von Belarus bis beispielsweise zum US-Luftstützpunkt Ramstein bei Kaiserslautern nur etwa sieben Minuten in der Luft sei – halb so lange wie bei einem denkbaren Abschuss vom Raketentestgelände Kapustin Jar bei Astrachan aus. Das Gegenargument gegen diese Vorwärtsstationierung lautet in der Regel, dass für hypothetische Angriffe gegen die Abschussbasen dieselbe verkürzte Vorwarnzeit gelte und der Nutzen daher nur für den Fall überraschender Angriffsoperationen gegeben sei.
Lukaschenko verwies als Argument für die geplante Stationierung darauf, dass die Manöverszenarien der NATO in Osteuropa immer offensiver würden. Anfang Juli zählte der belarussische Präsident auf, was die NATO im Rahmen einer Übung im Osten Polens – »nur ein paar Kilometer von unserer Grenze entfernt« – zusammenziehe: Zehntausende Soldaten und Hunderte gepanzerte Fahrzeuge unter anderem. Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Eskalation zu verringern, solle das im September angesetzte russisch-belarussische Manöver »Sapad 2025« mit weniger Beteiligten und in größerer Entfernung von der Grenze zur NATO stattfinden.
Thema Kaliningrad
Der Ort des Treffens der beiden Präsidenten scheint nicht ganz zufällig gewählt worden zu sein. Denn die Insel Walaam mit einem historischen orthodoxen Kloster liegt im Ladogasee nordöstlich von St. Petersburg. Auf diesen größten Süßwassersee Europas konzentriert sich derzeit die Aufmerksamkeit der russischen Marine. Die Invasionsdrohungen gegen die Exklave Kaliningrad, wie sie US-General Christopher Donahue erst Mitte Juli bei einer Veranstaltung in Wiesbaden wiederholt hatte, werden in Moskau erkennbar ziemlich ernstgenommen. Da Kaliningrad inzwischen an den Landgrenzen von NATO-Staaten umgeben ist, wird ein solcher Invasionsversuch in Russland offenbar nicht mehr ausgeschlossen. Die eine Reaktion darauf ist eine – übertragen gemeint – Salve von Artikeln auf militärnahen russischen Portalen, in denen für diesen Fall mit einem sofortigen Atomschlag gegen Polen und/oder Deutschland gedroht wird. Der Westen habe die Angst vor einer russischen Vergeltung verloren, ihm müsse wieder Respekt eingebläut werden, ist der rhetorische Tenor dieser Beiträge. Das korrespondiert mit offizielleren Aussagen über die nochmalige Senkung der Einsatzschwelle für die russischen Atomwaffen. War ein Atomschlag bisher Situationen vorbehalten, in denen die Existenz Russlands oder seines belarussischen Alliierten gefährdet sei – was man auch im Falle eines Verlusts von Kaliningrad mit einiger Berechtigung anzweifeln könnte – , hieß es nun, Atomwaffen seien auch anwendbar, um »strategische Interessen der Vertragspartner« zu schützen – darunter würde die Abwehr eines Angriffs auf die Region Kaliningrad durchaus fallen. Die andere Option sind offenbar recht fortgeschrittene Überlegungen, Teile der Ostseeflotte ins Innere Russlands zu verlegen (siehe Artikel unten).
Hintergrund: Schläge gegen Infrastruktur
Russland hat in den vergangenen Tagen seine Angriffe gegen die ukrainische Verkehrs- und Energieinfrastruktur intensiviert. Den Anfang machte am Montag ein Großangriff auf den Eisenbahnknotenpunkt Losowa im Bezirk Charkiw. Über die Station wird ein Großteil des aus Richtung Kiew an die Front ins Donbass laufenden Nachschubs für die ukrainischen Truppen im Raum Pokrowsk abgewickelt. Am Donnerstag morgen folgte ein weiterer Schlag gegen den Bahnhof Tschapline im Bezirk Dnipropetrowsk – damit ist auch die zweite wichtige Bahnlinie aus dem Donbass nach Westen in die Industriezentren Dnipro und Saporischschja zumindest zeitweise lahmgelegt.
Parallel dazu hat Russland in der Nacht zum Mittwoch den zentralen Anlandepunkt für Gas aus Aserbaidschan an der Schwarzmeerküste in Orliwka bei Odessa zerstört. Aserbaidschan hat sich zum wichtigsten Gaslieferanten der Ukraine entwickelt. Die Reparatur der Anlagen dürfte Monate dauern und sich somit bis in den Winter hinziehen. Derzeit hat die Ukraine nur 17 Prozent der für einen durchschnittlich kalten Winter erforderlichen Gasmenge in ihren Speichern. Die Umschlagstation bei Odessa diente in der Vergangenheit auch dazu, die Ukraine mit Gas aus Griechenland, Rumänien und der Türkei zu versorgen. Auch dieser Nachschubweg scheint vorerst verbaut.
Im übrigen gibt es von ukrainischer Seite bisher nicht bestätigte Berichte darüber, dass russische Stoßtrupps in einen Randbezirk von Cherson am rechten Dniproufer vorgestoßen sind. Russland hatte diesen Frontabschnitt zuletzt durch die Bombardierung der einzigen Brücke, die den auf einer Insel gelegenen Stadtbezirk Korabel mit dem Zentrum verbindet, weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten. Die Evakuierung von Zivilisten von der Insel verläuft offenbar schleppend, weil der ukrainischen Seite dafür nach Zerstörung der Brücke nur noch Boote zur Verfügung stehen. (rl)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
 Alexander Ratz/REUTERS05.04.2025
Alexander Ratz/REUTERS05.04.2025Freischwimmer im EU-Teich
 IMAGO/Bestimage02.12.2024
IMAGO/Bestimage02.12.2024Selenskij pokert mit NATO
 Oleksandr Klymenko/REUTERS12.04.2022
Oleksandr Klymenko/REUTERS12.04.2022Was zuvor geschah …
Mehr aus: Schwerpunkt
-
Taktischer Rückzug
vom 08.08.2025