Pragmatische Lösung
Von Florian Osuch
Das Verhältnis der Staatsführung der DDR zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage war ein ganz besonderes. Die auch als Mormonen bezeichnete christliche Glaubensgemeinschaft hatte dort nur einige tausend Mitglieder. Trotzdem gelang es der Kirche, dass ausgerechnet in der säkularen DDR ihr erster Tempel auf deutschem Boden errichtet wurde. Das Gotteshaus im sächsischen Freiberg wurde vor 40 Jahren, am 29. Juni 1985, von Gordon Hinckley von der Kirchenleitung aus den USA eingeweiht. Es war der einzige Mormonen-Tempel, der jemals in einem sozialistischen Land errichtet wurde. In Europa war er nach den Tempeln in Bern (gebaut im Jahr 1955) und London (1958) der dritte dieser Art. Die Beantwortung der Frage, weshalb im beschaulichen Freiberg ein solcher Bau errichtet wurde, kann nur geschichtlich erfolgen.
Die Kirche mit dem etwas sperrigen Namen wird umgangssprachlich mit LDS abgekürzt, angelehnt an die englische Bezeichnung »The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints«. Ihre Mitglieder nennen sich »Heilige der Letzten Tage« und sprechen einander mit Bruder oder Schwester an. Gegründet wurde die LDS 1830 in den USA, die Zentrale sitzt in Salt Lake City im Bundesstaat Utah. Die weltweit rund 17 Millionen Mitglieder sehen sich als Teil einer wiederhergestellten Urkirche. Hierzulande gehört sie nicht der 19 Mitglieder umfassenden »Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen« an. Für Außenstehende sind die Unterschiede zu den Spielarten des Christentums jedoch gering, da Mormonen zentrale Elemente teilen: Altes und Neues Testament, Jesus als zentrale Figur, Israel als heiliges Land, christliche Feiertage etc. Ergänzt wird der biblische Kanon durch »Das Buch Mormon« und andere Schriften. Für die LDS gilt die Familie als heilig und als Kern göttlicher Ordnung. Kinderreichtum wird als Segen verstanden. Die Kirche vertritt konservative Werte. Höhere Ämter sind Männern vorbehalten, gleichgeschlechtliche Liebe kann zum Ausschluss führen. Allerdings gibt es seit 1977 auch schwul-lesbische Organisierung innerhalb der Kirche, die heute als »LGBTQ Mormons, Families & Friends« auftritt. Die rassistische Praxis, Schwarze von höheren Ämtern auszuschließen, wurde 1978 aufgegeben. Die Kirche betreibt eigene Hochschulen, wie die Brigham Young University in Provo, Utah mit 35.000 Studierenden.
Mitte des 19. Jahrhundert kamen die ersten Mormonen nach Europa. In Deutschland blieb ihre Zahl jedoch klein, viele Konvertierte zog es in die USA. Das Kaiserreich ging repressiv gegen die Kirche vor. In der Weimarer Republik war Religionsfreiheit garantiert und die LDS wuchs im Deutschen Reich, Österreich und der Schweiz auf rund 11.500 Mitglieder an.
Unter den Nazis war ihre Religionsausübung wieder teilweise eingeschränkt. Das geht aus Akten der Gestapo, des Sicherheitsdiensts/SD und anderen Stellen hervor, die die LDS-nahe B. H. Roberts Foundation voriges Jahr veröffentlichte.¹ Stiftungsdirektor Josh Coates fasste in Deseret News zusammen: Die Unterlagen zeigten »das Misstrauen und die Verachtung der NS-Regierung gegenüber deutschen Heiligen«. In einem Dossier für das »Amt Rosenberg« (einer seit 1934 bestehenden Dienststelle zur Überwachung des Kultur- und Bildungsbereichs unter Leitung des Naziideologen Alfred Rosenberg) vom August 1938 hieß es, die Lehren dieser »jüdisch-christlichen Sekte« stünden im »krassen Gegensatz zur nationalsozialistischen Weltanschauung«. Die Kirche wandelte laut Coates auf einem »schmalen Grat zwischen vorsichtiger Unterwerfung und stillem Widerstand«.² Mehrheitlich hätten sich die Mormonen »zwar gesetzestreu (verhalten), aber meist sorgfältig vom Nationalsozialismus distanziert«. Eine Minderheit habe das faschistische Regime unterstützt. In Berlin soll ein Gläubiger, der 1928 der SA beigetreten war, 1933 im »SA-Gefängnis Papestraße« mehrere Inhaftierte gefoltert und ermordet haben.³
In Plötzensee geköpft
Es gab auch mutige antifaschistische Mormonen. In Hamburg bildete der junge Helmuth Hübener mit seinen Glaubensbrüdern Rudolf Wobbe und Karl-Heinz Schnibbe eine kleine Widerstandsgruppe.⁴ Sie stellten Flugblätter her, wurden jedoch denunziert. Hübener wurde wegen »landesverräterischer Feindbegünstigung« zum Tode verurteilt, Wobbe und Schnibbe erhielten lange Haftstrafen. Hübener wurde 1942 mit nur 17 Jahren in Berlin-Plötzensee mit der Guillotine ermordet.⁵ Den Weg konsequenter Verweigerung, wie ihn viele Mitglieder der Zeugen Jehovas gingen und dafür als »Bibelforscher« mit dem lila Winkel in Konzentrationslager verbracht und zu Hunderten ermordet wurden, beschritten die Mormonen jedoch nicht.
Vollständig zum Erliegen kam jedoch die Aktivität von Missionaren. Die LDS-Führung in Utah wies 1938 alle Missionare an, das Deutsche Reich zu verlassen. Gleichzeitig unterstützten die Heiligen ihre Brüder und Schwestern in Deutschland materiell. Im Zuge eines innerkirchlichen Wohlfahrtsprogramms wurden Lebensmittel, Kleidung etc. gespendet. Die Erfahrung von Repressalien sowohl in der Kaiserzeit als auch unter den Nazis trug später dazu bei, die DDR wertzuschätzen, wenngleich sich auch dort das Gemeindeleben nicht wie gewünscht entfalten konnte.
Nach der Befreiung vom Faschismus nahm die LDS in allen Besatzungszonen ihre Arbeit wieder auf. Die internationale Hilfe lief ebenso wieder an. In Ostdeutschland war die Unterstützung mit der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) abgesprochen. Die SMAD stand den Mormonen skeptisch gegenüber, hatte allerdings mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen, als die Einfuhr religiöser Schriften zu regulieren oder sich sonstwie mit unliebsamen, aber politisch harmlosen Gruppierungen zu befassen. Der Kirche gehörten in dieser Zeit auf dem Gebiet der DDR etwa 6.000 Mitglieder an.
Abwanderung gen Westen
Mit Gründung der DDR 1949 war den Mormonen ihre Tätigkeit per Verfassung garantiert. Die »ungestörte Religionsausübung« wurde durch Artikel 41 der Verfassung gewährleistet. Staat und Kirche waren getrennt, das entsprach auch einem Grundsatz der LDS. Trotzdem beklagten die Mormonen Schikanen. Hinzu kam, dass die Kirche mit Abwanderung in die USA und Richtung BRD zu kämpfen hatte. Ihre Mitgliederzahl sank. Die gesamtdeutsche Leitung saß in Westberlin und später in Hamburg. Das 1950 gegründete Ministerium für Staatsicherheit (MfS) beäugte die aus den USA gelenkte Kirche kritisch, bezeichnete sie zunächst als »Sekte« und überwachte ihre Aktivitäten.
Trotzdem forderte David McKay, 9. Präsident der LDS, deren Anhänger in der DDR auf, dort zu bleiben. McKay reiste 1952 nach Westberlin und zahlreiche Mormonen aus der DDR besuchten die Versammlung, darunter auch der Mormone Gerd Skibbe aus Wolgast. Laut seinen Erinnerungen predigte der Kirchenführer: »Tut eure Pflicht gegenüber Gott, indem ihr seine Gebote haltet, dann wird die Indoktrination durch den sogenannten wissenschaftlichen Atheismus eure Familien nicht in feindliche Lager spalten. (…) Bleibt wo ihr wohnt, helft, wo ihr lebt, die Kirche – das Reich Gottes – aufzubauen.«⁶ Der von den Mormonen als Prophet verehrte Präsident hatte gesprochen und seinem Wort war unbedingt Folge zu leisten. Ein Glaubensgrundsatz der Kirche besagt zudem, weltliche Ordnung grundsätzlich anzuerkennen.
Für größere Schwierigkeiten sorgte jedoch der für die Mormonen wichtige Besuch des nächstgelegenen Tempels in der Schweiz. Zwar hatte die LDS in der DDR eigene Räume für Taufe und Konfirmation. Die wichtigsten Zeremonien – Endowment, Siegelung (Eheschließung) und die stellvertretende Taufe Verstorbener – sind aber Tempeln vorbehalten. Das Endowment ist eine Art spiritueller Glaubenstest, bei dem die Kandidaten einen strengen und frommen Lebensstil ohne Alkohol, Nikotin und Sex nachweisen müssen. Dafür dürfen sie beim Endowment einen heiligen Saal des Tempels, den »celestialen Raum«, betreten.
Schon vor dem Mauerbau war es für DDR-Bürger schwierig, in die Schweiz oder in andere Staaten des nichtsozialistischen Auslands reisen; das lag nicht nur an den strengen Regelungen des Arbeiter- und Bauernstaates.
Nach dem Mauerbau 1961 waren Reisen weitgehend unmöglich. Der Kontakt zwischen Ost und West kam jedoch nicht zum Erliegen. Die Mormonen waren umtriebig: Während der halbjährlich ausgerichteten Messe in Leipzig reisten Kirchenobere von der gesamtdeutschen Leitung aus Westdeutschland an, zu gleichzeitig abgehaltenen Tagungen. Das fiel nicht weiter auf und war auch nicht verboten. Verantwortlich für die Tätigkeiten der LDS in der DDR war damals Henry Burkhardt (1930–2019), späterer Präsident des Tempels in Freiberg. Er traf sich auch regelmäßig in Ostberlin mit Kirchenführern aus den USA, die als Touristen in die Hauptstadt der DDR reisten.
Die Mauer als Segen
Durch den Mauerbau kam die Abwanderung zum Erliegen. Was als Einschränkung wahrgenommen wurde, entpuppte sich für die Mormonen als Chance. Manfred Schütze, wie Burkhardt leitend für die Kirche in der DDR und auch im wiedervereinigten Deutschland tätig, bezeichnete den Bau der Mauer als »das Beste, was uns passierte« und als »Segen«.⁷ In den 1950er Jahren seien viele Gläubige gegangen, »einfach, weil sie glaubten, und mit Recht glaubten, dass (in der DDR) ihr Leben nach den Grundregeln der Kirche nicht immer möglich« sei. Einige Gemeinden standen vor dem Aus.
Wie das MfS die verfassungsmäßig garantierte Religionsausübung einschränkte, kann an einem Beispiel vom Sommer 1968 dargestellt werden. Die Kirche plante einen Freizeitmarsch für 150 jugendliche Kirchenanhänger aus der DDR und der Tschechoslowakei. Eine Genehmigung wurde beantragt für Übernachtungen, Bustransfer, Gottesdienste und Tanzveranstaltungen. Völlig harmlos, doch das MfS meinte, derlei Aktivitäten der »amerikanisch gelenkten Sekte« stünden »im Widerspruch zu den gesetzlichen Bestimmungen«.⁸ Laut Akten des für Kirchen zuständigen »Hauptabteilung XX« des MfS sei zu prüfen, »ob staatlicherseits eventuell Maßnahmen einzuleiten wären – unter Umständen eine Aussprache mit dem Leiter der ›Mormonen‹ im Gebiet der DDR, Burkhardt – mit dem Ziel, den geplanten ›Pioniermarsch‹ zu verhindern.« Die Behörden folgten dem MfS und erteilte keine Genehmigung.
Trotz Überwachung durch das MfS und anderen Schikanen – einigen wurde das Studieren versagt – wählten die Mormonen den Weg der Anpassung. Unterkriegen ließen sie sich jedoch nicht. Hartnäckig stellten sie Anträge, zum Beispiel für die Genehmigung des Imports religiöser Schriften. Mal wurden diese genehmigt, mal abgelehnt. Zurückweisungen erfolgten unter anderem mit Verweis auf das Frauenbild, das in den Texten verbreitet wurde. Vorstellungen, wonach die Frau zwecks Kindererziehung zu Hause bleiben müsse und die gläubige Familie den staatlichen Erziehungsauftrag zu Hause ersetzen solle, widersprachen der Rolle der selbstbewussten Arbeiterin in der DDR. Anträge zur Ausreise zum Besuch des Tempels in der Schweiz wurden in wenigen Ausnahmefällen für Männer erteilt. Das machte für die Mormonen wenig Sinn, wollten sie dort doch die »Siegelung« ihrer Partnerinnen vollziehen. Diese und andere Problematiken wurde regelmäßig mit dem 1957 gegründeten Staatssekretariat für Kirchenfragen besprochen.
Insgesamt habe sich die DDR jedoch »kaum für die Ränder des religiösen Feldes« interessiert.⁹ Bei den Mormonen gab es jedoch ein Spezifikum. Mitglieder der LDS bekleideten in den USA teils hohe Ämter in der Politik und in der Republikanischen Partei. Ezra Taft Benson war acht Jahre Minister im Kabinett Eisenhower, später wurde er der 13. Präsident der Kirche. Der Mormone George Romney (Vater von Mitt Romney) war in den 1960er Jahren Gouverneur von Michigan und dann Minister unter Richard Nixon.
Angst vor US-Einfluss
Ab 1968 war Thomas Monson von der Kirchenführung in den USA zuständig für Europa. Als Tourist reiste er in die DDR, um dort zu predigen. Monson, von 2008–2018 der 16. Präsident der LDS, gehörte damals dem zweithöchsten Gremium, dem »Kollegium der Zwölf Apostel« an. Die Heiligen der Letzten Tage verehren auch die Mitglieder dieses Kollegiums als Propheten Gottes. Die Fremdsteuerung aus den USA gefiel der DDR-Regierung allerdings nicht. Sie forderte, die Kirche müsse von einem Staatsbürger geführt werden. Monson reagierte pragmatisch und erklärte die DDR kurzerhand zu einem eigenständigen Gebiet, und setzte Henry Burkhardt als Präsidenten ein. Burkhardt war nun offizieller Ansprechpartner, und er unterstand fortan direkt Utah und nicht mehr Westdeutschland. Diese Art Pragmatismus sollte später Schule machen. Trotz Trennung von der Hamburger Leitung warnte das Staatssekretariat für Kirchenfragen jedoch vor »amerikanischen Einfluss«. In internen Unterlagen war man der Auffassung, durch die Steuerung aus Salt Lake City »vergrößere sich die Möglichkeit, dass Versuche unternommen werden, die ›Mormonen‹ im Gebiet der DDR in die Aggressionspolitik des US-Imperialismus einzubeziehen«.¹⁰
In den 1970er Jahren entspannte sich das Verhältnis zwischen der Kirche und der Staatsführung, analog zur Annäherung zwischen der DDR und der BRD. 1972 wurde Henry Burkhardt erstmals die Ausreise zur Generalkonferenz der Kirche in die USA gestattet. Fortan reisten Burkhardt und seine Berater einmal im Jahr zur wichtigen Konferenz nach Salt Lake City. Für eine Gebietskonferenz im August 1973 in München hoffte man, mit einer größeren DDR-Delegation reisen zu können. Doch die Behörden zeigten Härte. Statt wie gewünscht Hunderten, wurden nur sieben Mitgliedern die Ausreise gestattet. Die Gläubigen kannten jedoch die Schlupflöcher des DDR-Rechts. Für Rentner gab es seit 1964 die Möglichkeit, einmal im Jahr die DDR für bis zu vier Wochen zu verlassen. Über einhundert Pensionäre sollen so nach München gefahren sein. Das Staatssekretariat für Kirchenfragen schnaubte und bestellte Burkhart ein. Doch der wusste, welche Schlagworte die Behörden hören wollten. Er führte aus, die Reisenden hätten in Westdeutschland »so viel moralischen Schmutz, Pornoläden und Rauschgiftverkauf« gesehen, dass sie gerne wieder »in die Ruhe der moralischen Sauberkeit unseres Staates zurückgekehrt« seien.¹¹
Mit den Ergebnissen der »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa« (KSZE) und der »Schlussakte von Helsinki« vom August 1975 konnten die Kirchen in der DDR ihre Forderungen nach größerer Entfaltung unterstreichen, auch die Mormonen. Der Import religiöser Schriften wurde vereinfacht, doch Behörden versagten kontinuierlich Ausreisen zum Tempel in die Schweiz. Im August 1977 machte erstmals ein LDS-Präsident Station in der DDR. Vor 1.400 Mitgliedern äußerte Spencer Kimball, der 12. Präsident der Kirche, auch mit den sozialistischen Regierungen auskommen zu wollen. Im März 1978 traf sich der SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende Erich Honecker mit den Spitzen der protestantischen Landeskirchen. Der Staat sagte umfangreiche Erleichterungen zu, darunter Zulassung kirchlicher Sendungen im Fernsehen, Förderung religiöser Kindergärten oder die Unterstützung kirchlicher Bauvorhaben. Die SED formulierte ihrerseits die Erwartung, die Religionsgemeinschaften hätten die Friedenspolitik von Staat und Partei gutzuheißen.
Wenige Wochen später traf sich Henry Burkhard erneut mit Vertretern des Staatssekretariats für Kirchenfragen. Da weiterhin die Ausreise einer größeren Zahl LDS-Mitglieder nicht möglich sei, unterbreiteten die DDR-Funktionäre einen pragmatischen Vorschlag: Die Kirche solle prüfen, in der DDR einen eigenen Tempel zu errichten. Der überrumpelte Burkhard entgegnete, so ein Unterfangen wäre ganz und gar nicht möglich: Die Gemeinden seien zu klein und über Tempelbauten habe die Kirchenführung in den USA zu entscheiden. Auch in Utah unternahm man zunächst weitere Versuche, auf dem Weg des Dialogs Möglichkeiten der Ausreise zu erreichen. Doch die SED blieb stur. Also begann man in Utah mit der Planung für den Bau des ersten Tempels in einem sozialistischen Land.
Es folgten Verhandlungen und Gespräche im Dreieck zwischen der Kirchenführung aus den USA, die den Bau in Devisen bezahlte, den Beauftragten der LDS in der DDR sowie dem Kirchensekretariat bzw. Behörden in der Stadt Freiberg. Am 23. April 1984 wurde feierlich und unter Anwesenheit von Kirchen- und Regierungsvertretern der symbolische erste Spatenstich durchgeführt – samt Predigt, der laut Burkhardt auch »alle Kommunisten mit gesenktem Kopf und gefalteten Händen« beiwohnten.
Die Einweihung des weltweit 33. Tempels der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage erfolgte vor genau 40 Jahren. Als Repräsentant der DDR-Regierung war Hermann Kalb, Mitglied der Volkskammer der DDR für die CDU (Ost) und Stellvertreter des damaligen Staatssekretärs für Kirchenfragen anwesend. Sein Chef, der Staatssekretär Klaus Gysi, hob damals gegenüber Neues Deutschland hervor, »die Errichtung des Tempels bestätige das Prinzip der völligen Gleichberechtigung aller religiösen Überzeugungen in der DDR«.
Win-Win-Situation
Der damalige LDS-Präsident für Europa, Josef Wirthlin, würdigte das Bauwerk als einen »deutlichen Beweis für die Glaubens- und Gewissensfreiheit« in der DDR. Die Hartnäckigkeit von Burkhardt und den Vertretern aus den USA wurde belohnt. Das Einzugsgebiet des Tempels erstreckte sich bis in die Sowjetunion. Auch Heilige aus Skandinavien und aus der BRD reisten fortan nach Freiberg.
Vor der Einweihung des Tempels öffnete die Kirche ihren neuen Bau für Interessierte. Innerhalb von zwei Wochen kamen 90.000 Besucher und bestaunten die prunkvollen Räumlichkeiten. Der Regierung Honecker war ein kleiner Coup gelungen. Erstens entstand ausgerechnet in der mehrheitlich konfessionslosen DDR der erste Mormonen-Tempel auf deutschem Boden. Die christlich geprägte BRD hatte das Nachsehen; dort wurde erst 1987 in Frankfurt am Main ein Tempel geweiht. Zweitens konnte sich die SED den zunehmend kritisch eingestellten evangelischen Landeskirchen als liberal gegenüber dieser christlichen Minderheit zeigen. Drittens präsentierte sich die DDR auch international offen, souverän und kooperativ. Der Staat war um internationale Anerkennung insbesondere durch nichtkommunistische Staaten bemüht. Hinzu kamen die Devisen, die der klamme Staat dringend brauchte.
Doch schon vor dem Bau des Tempels hatte sich das viele Jahre schlechte Verhältnis zwischen der LDS und staatlichen Stellen gebessert. Die Kirche hatte kein Problem mit den im März 1978 von Honecker formulierten Erwartungen, man möge die Friedenspolitik der SED gutheißen. Wohlwollend dürfte man in Ostberlin zur Kenntnis genommen haben, dass Kirchenführer Spencer Kimball sich im Mai 1981 gegen die Stationierung von Interkontinentalraketen, den sogenannten »MX Missiles«, in Utah aussprach. Das verstoße gegen die »Verbreitung des Friedensevangeliums«. In der DDR profitierten beide Seiten von den zunehmend freundlicher werdenden Kontakten. Im Oktober 1988 empfing Erich Honecker mit Thomas Monson und Russel Nelson, den aktuell amtierenden Präsidenten der LDS, oberste Kirchenführer aus den USA. Vergleichbare Treffen gab es in Bonn, Paris oder London nicht. Mit einem langen Schreiben umgarnte die LDS den Staatsratsvorsitzenden: »In Ihrer Person verehren wir den Repräsentanten unserer Heimat, unseres Staates, mit dem wir uns identifizieren, in dem wir glücklich sind.« Die LDS insgesamt unterstützte »unsere Regierung bei ihrem Bemühen um Koexistenz, Frieden und gute Nachbarschaft«. Die Kirche wolle »den Weg des gewachsenen Vertrauens und der gegenseitigen Achtung« weitergehen. Die Mitglieder in der DDR würden durch »eine christliche Lebensführung« einen »Beitrag für die Stärkung unseres sozialistischen Landes und damit auch für die Erhaltung des Friedens« leisten.¹² Honecker wurde sogar nach Utah eingeladen, doch zu dem Besuch kam es nicht mehr.
»Groteskes Phänomen«
Die Errichtung des Tempels in Freiberg und weiterer Gemeindehäuser war Teil des »Kirchenbauprogramms der DDR«. Seit den 1960er Jahren gab es Kooperationen für die Sanierung und den Bau neuer Kirchen zwischen der evangelischen und katholischen Kirche der BRD und der Regierung in Ostberlin. Die Kosten mussten die Westkirchen bzw. die Regierung in Bonn in D-Mark bezahlen – eine attraktive Einnahmequelle für die DDR. Im ganzen Land wurden Dutzende teils bedeutende Kirchen restauriert, so die Nikolaikirche in Leipzig, das Augustinerkloster in Erfurt oder der Berliner Dom. Der Ministerrat der DDR beschloss Mitte der 1970er Jahre ein »Sonderbauprogramm«, das später von Erich Honecker erweitert wurde. So entstanden bis zur Wiedervereinigung knapp einhundert neue Kirchen aller christlichen Strömungen.
Dieser Kurs hatte in der DDR auch Kritiker. Klaus Gysi, von 1979 bis 1988 Staatssekretär für Kirchenfragen, musste sich mehrfach dafür rechtfertigen – auch für den Bau des Tempels in Freiberg. Im Dissens stand er dabei beispielsweise mit dem Schriftsteller Peter Hacks, der 1992 rückblickend polterte: »Dann gab es diese grotesken Phänomene, dass wir Religionen einführten, die es bisher gar nicht gab, also die Mormonen z. B. (Sie) kriegten von Herrn Honecker einen Tempel gebaut, den einzigen in Europa, wo wieder die Leute aus aller Welt kamen, und viele Devisen hierließen (…).«¹³ Zwar irrt Hacks hier gleich doppelt – Mormonen lebten in der DDR seit ihrer Gründung und der Tempel in Freiberg war der dritte seiner Art in Europa –, das Zitat verdeutlicht jedoch die kritische Haltung eines überzeugten Sozialisten und Atheisten.
Der Tempel in Freiberg blieb auch nach den Umbrüchen 1989/90 der einzige Tempel für Osteuropa. Bei Neubauten legte die Kirche den Fokus auf Westeuropa, so in Madrid im Jahr 1999, Den Haag (2002), Kopenhagen (2004) und Helsinki (2006). Erst im Jahr 2010 wurde ein Tempel in der ukrainischen Hauptstadt Kiew errichtet.
Anmerkungen
1 Das Material des Bundesarchivs (R 58/5686) ist veröffentlicht unter: https://bhroberts.org/projects/gestapo
2 Josh Coates: Nazi archives reveal the regime’s disdain for the Church of Jesus Christ. In: Deseret News (12.11.2024), online: www.deseret.com/faith/2024/11/12/nazis-disliked-latter-day-saints/
3 Vgl. David Conley Nelson: Moroni and the Swastika: Mormons in Nazi Germany. Oklahoma 2015
4 Vgl. Ulrich Sander: Jugendwiderstand im Krieg. Die Helmuth-Hübener-Gruppe 1941–1942. Bonn 2002
5 In Hamburg erinnert ein Stolperstein an Helmuth Hübener, eine Schule und eine Straße sind nach ihm benannt, siehe: https://presse-de.kirchejesuchristi.org/artikel/auf-den-spuren-helmuth-huebeners-in-hamburg
6 Vgl. Gerd Skibbe: Schritte durch zwei Diktaturen. Friedrichsdorf 2005
7 Raymond Kuehne: Mormonen und Staatsbürger. Eine dokumentierte Geschichte der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage in der DDR. Leipzig 2010, S. 130
8 Vgl. Akten des BStU, Einzelinformation Nr. 676/68
9 Vgl. Andreas Stegmann: Die Kirchen in der DDR. München 2021, S. 55
10 Vgl. Kuehne, S. 149
11 Vgl. Kuehne, S. 156
12 Vgl. Akten des BStU, Information Nr. 425/88
13 Heinz Hamm (Hrsg.): Marxistische Hinsichten. Politische Schriften 1955–2003. Berlin 2018, S. 285
Florian Osuch schrieb an dieser Stelle zuletzt am 14. Mai 2025 über die Folgen der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland: »Hintertür für Konzerne«
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Dieser Artikel gehört zu folgenden Dossiers:
Ähnliche:
 Carsten Milbret/imagebroker/imago22.03.2025
Carsten Milbret/imagebroker/imago22.03.2025Aufklärung für alle
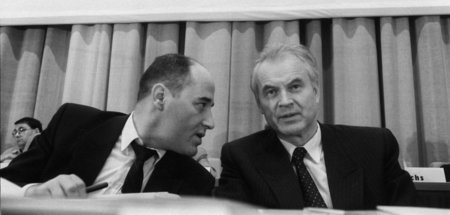 Peter Zimmermann/dpa/ZB10.01.2020
Peter Zimmermann/dpa/ZB10.01.2020Vorhersehbarer Verrat
 Paul Zinken/dpa03.12.2018
Paul Zinken/dpa03.12.2018Wahrheit und Versöhnung?
