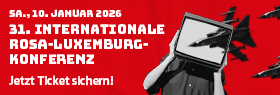Schrotti überalli
Von Frank Schäfer
»Findest du es nicht lächerlich«, fragt Rolf Dieter Brinkmann seine Frau Maleen in den nachgelassenen Tonbandaufnahmen »Wörter Sex Schnitt«, »deine Gedanken ausdrücken zu müssen durch Wörter?« Das alte Problem, das die sprachreflexiven Schriftsteller immer wieder zur Verzweiflung gebracht und doch nie vom Schreiben abgehalten hat. Man will die Welt hinter der Sprache abbilden, hat dafür aber nun mal nur die Sprache zur Verfügung. Mit einer gewissen Unschärfe muss man einfach leben, wenn man den Widerspruch einer solchen Faction-Ästhetik erkennt und trotzdem weiterarbeitet. Brinkmann laboriert eine Weile erheblich daran, zieht sich zurück aus der literarischen Öffentlichkeit, publiziert gar nichts mehr – geschrieben hat er dennoch, und wie! Verzweifelt, selbstzerstörerisch, aber auch furios und gattungssprengend. Er öffnete seine Literatur für andere Formate, inkorporiert allerlei visuelles Material, löst die lineare Form auf und ergeht sich in ausufernden Text-Bild-Collagen, um der wirklichen Wirklichkeit noch näherzukommen, um das Innerste, diese wirre Gemengelage aus Fühlen und Sehen und Denken und Immer-schon-Wissen doch noch irgendwie adäquat aufs Papier zu werfen.
Am eindrucksvollsten ist »Rom, Blicke«, dieses erst postum publizierte Album, das in Fotos, Postkarten, Quittungen, Stadtplänen, Collagen, Briefen an seine Frau Maleen sowie an Freunde und Kollegen, Lektürenotizen und fremden Texten seinen Aufenthalt in der Ewigen Stadt authentisch, möglichst eins zu eins abzubilden versucht. Eine gigantische Hasslatte: »Schrotti überalli«.
Kaum etwas hält seinem Exekutorenblick stand: nicht die Mitstipendiaten an der Villa Massimo, nicht die Linksintellektuellen, nicht der Kulturbetrieb, ein paar literarische Solitäre allerhöchstens – und seine Frau, der er seitenlang und beinahe quälend minutiös seine Befindlichkeiten beschreibt, quälend auch deshalb, weil er jegliche Stilisierung fahren lässt, ein amorphes Ad-hoc-Protokoll liefert, das auf den Leser keine Rücksicht nimmt – in dieser Form von Brinkmann aber ja auch nicht zum Druck vorgesehen war.
Rom wird ihm zur Großmetapher für die verwesende Zivilisation, ihren äußeren wie inneren Zerfall, für das zum Untergang verurteilte Abendland. Ein Katastrophismus, den er auch bei Hans Henny Jahnn, Gottfried Benn und Arno Schmidt vorgefunden hat und sich Anfang der Siebziger Jahre anverwandelt, in jener Zeit, als er die Hoffnung auf eine Sensibilisierung und damit auch Veränderung der Gesellschaft durch die Popsubkultur aufgeben muss.
Durch Brinkmanns rücksichtsloses dokumentarisches Stenogramm bekommen wir allerdings auch einen detailreichen Einblick in die Kulturszene der sich langsam sedierenden Protestgeneration: Kleidungs- und Diskussionsgebaren, Haartrachten, Strategien der Stipendienakquisition und andere Nichtigkeiten des intellektuellen Alltags, die man in keiner Kulturgeschichte findet. Beeindruckend ist es schon, dieses monomanische, alles, das heißt auch sich selbst sezierende Bewusstseinsprotokoll, aber über weite Passagen eben auch von einer prosaischen Nichtigkeit, einer Durchschnittlichkeit, stellenweise sogar von einer Dummheit und dumpfen Spießigkeit, die man diesem Renegaten und Rock ’n’ Roller eigentlich gar nicht zugetraut hätte. Wenn er zum Beispiel seine Frau lobt für einen gut geschriebenen Brief, dann hat das etwas so altväterlich Pädagogisches und wird mit einer Präzeptorengeste vorgetragen, dass man sich beinahe an Kleists unselige Brautbriefe erinnert fühlt.
Aber gerade, wenn die Lektüre zu nerven beginnt, landet man bei einer dieser kleinen lyrischen Inseln, die dann doch wieder versöhnlich stimmen: »Ich komme aus dem Moor, ich habe schwarze verkohlte Bahnböschungen hinter mir gelassen, früher Rock ’n’ Roll darüber geweht, verbranntes Stangenpulver, ein ausgebleichtes Kornfeld im Sommer mit hineingetretenen verwirrenden Gängen, den Geruch von blühender zerriebener Kamille, und ich bin durch Großstädte geschleift, ich bin in Urinlachen geschwommen und habe allerlei dunkle Dinge gesehen und habe einiges kurz davon gekostet – was also solls, was die ›moderne‹ Welt mir zu bieten hat?«
»Rom, Blicke« hatte auch deshalb so großen Erfolg, weil die manische Tipperei sehr schön das Stereotyp vom genialischen, sich zuschanden schreibenden Dichter bestätigt. Man muss deshalb immer wieder darauf hinweisen, dass dieses Buch ohne Brinkmanns Tod zur Unzeit überhaupt nicht erschienen wäre, schon gar nicht in dieser kruden Form.
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Regio:
Mehr aus: Feuilleton
-
Nachschlag: Trump-Erfinder
vom 04.08.2025 -
Vorschlag
vom 04.08.2025 -
Veranstaltungen
vom 04.08.2025 -
Geschäfte und Wunder
vom 04.08.2025 -
Tolle Frauen
vom 04.08.2025 -
Das Entlein ein Schwan
vom 04.08.2025