Opium der Intellektuellen
Von Ingar Solty
Man kann Nietzsche als Aufforderung lesen, alles anzuzweifeln. Für die Konventionellen ist »Zweifel Sünde«. Damit aber verhindern sie, fand Nietzsche, jeden Fortschritt, jede geistig-kulturelle Höherentwicklung. Seine Frage: Wie kann »Vernünftiges aus Vernunftlosem, Empfindendes aus Totem, Logik aus Unlogik, interesseloses Anschauen aus begehrlichem Wollen, Leben für andere aus Egoismus, Wahrheit aus Irrtümern«, kurz »etwas aus seinem Gegensatz entstehen«? Seine Antwort: durch die »freien Geister«. Ihre Funktion ist für Nietzsche die der »Veredelung durch Entartung«: Die Gemeinschaft funktioniere am besten durch die »Unterordnung des Individuums«, aber diese Konformität führe zu »gesteigerter Verdummung«. Das »geistige Fortschreiten« hänge von den »ungebundneren, viel unsichereren« Individuen ab, »die Neues und überhaupt vielerlei versuchen«. Innovativ zu sein, das ist für Nietzsche die Funktion der Querdenker, originellen Genies, Übermenschen. »Wo ein Fortschritt erfolgen soll«, da müssen »die abartenden Naturen« provozieren, »von Zeit zu Zeit dem stabilen Elemente eines Gemeinwesens eine Wunde« zufügen, denn in diese könne auch »etwas Neues und Edles inokuliert werden«.
Man kann Nietzsche auch als Aufforderung verstehen, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, als wäre er ein Aufklärungsphilosoph. Zweifellos ist das Antisystematische ein wesentliches Element der »Zerstörung der Vernunft« auf dem Weg in den Faschismus; zugleich aber ist er auch ein vehementer Unterstützer der Renaissance, und zwar nicht nur als Wiedergeburt der hellenistischen Tradition, sondern als Inwerksetzung des freien Geistes und »goldenen Zeitalters dieses Jahrtausends«.
Nietzsches 20. Jahrhundert
Aber so aufklärerisch Nietzsche wirkt, das Besondere an ihm ist die – in seinem elitären Kulturpessimismus und seiner narzisstischen Menschenfeindlichkeit wurzelnde – konsequente »Aufhebung der Gattungsemanzipation des Menschen in einer über die Aufklärung aufgeklärten Aufklärung als politischer Kastenordnung«.
Mit dieser Denkweise steckte er nach seinem Tod Millionen Heranwachsende an, die entfremdet und auf der Suche nach sich selbst in einen Gegensatz zum Bestehenden gerieten. Sie mögen sich wiederfinden in »Also sprach Zarathustra«: »Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch – ein Seil über einem Abgrunde (…). Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer.«
Es steckte viel Nietzsche in der Jugend- und bündischen Bewegung, die sich später in Nazis (»Kraft durch Freude«-Bewegung) und Antinazis (Edelweißpiraten) spaltete. Das Werk von Hermann Hesse war durch und durch nietzscheanisch: »Nur für Verrückte.« Auch die Frankfurter Schule der »nonkonformistischen Intellektuellen« (Alex Demirovic) mit ihrer »Sehnsucht nach dem ganz Anderen« (Max Horkheimer) und der Huldigung des bürgerlichen Individuums des 19. Jahrhunderts ist ohne Nietzsche überhaupt nicht zu denken. Er steckt in der Dissidenz des Existentialismus – von der Philosophie Jean-Paul Sartres bis zum literarischen Werk von Alfred Andersch – und seiner Suche nach Willensfreiheit und Subjektsouveränität. Auch der Siegeszug des Psychologischen in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts, der Psychologie als Wissenschaft, »die notwendig ist, weil die Wissenschaft ihrer nicht entraten kann«, ist nicht nur Freuds, sondern auch Nietzsches Werk. Ja, es steckt sogar in Bertolt Brechts Hausapotheke, in Franz Josef Degenhardt, wo dieser in »Deutscher Sonntag« singt, dass es ihn »vor Gemütlichkeit friert«, so wie Zarathustra gegen das »erbärmliche Behagen« wettert, das es mit »Verachtung« zu strafen gelte.
Nietzsche klingt stellenweise wie Rousseau in seinem pädagogischen »Émile«, wo er in der Gesellschaft das Unterdrückerische und im Kind die zu befreiende Unschuld und Kreativität vermutet. Er klingt wie Freud mit seiner Theorie von der Gesellschaft, die dem »Es« das »Über-Ich« der Konvention aufpfropft und erst damit die Zivilisation schafft – die Nietzsche aber ablehnte. Entscheidend war die Frage der Gleichheit, die er zur Ungleichheit hin auflöste: Von den Konventionen befreien können sich nur die Genies, die »Übermenschen«, die sich die verachtete Masse in einem »Willen zur Macht« auch dienstbar machen dürfen.
Sicher blieb für Nietzsche, den »aristokratischen Rebell« (Domenico Losurdo), der Widerspruch, dass die Befreiung des »Es« das abgelehnte Plebejische hervorbringt. Diesen Widerspruch aber suchte er mit dem »Über-Tier« aufzuheben: »Ohne die Irrtümer, welche in den Annahmen der Moral liegen, wäre der Mensch Tier geblieben«, argumentierte er analog zu Freud. Und daraus erwachse der »Haß gegen die der Tierheit näher gebliebenen Stufen: woraus die ehemalige Mißachtung des Sklaven als eines Nicht-Menschen, als einer Sache, zu erklären« sei. Und doch ging es Nietzsche darum, das innere Tier als Raubtier von der Kette zu lassen: »Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib«, jetzt aber gehe es um die Priorisierung des Leibes, des Subjektwollens.
Antikapitalismus?
Nietzsche blieb aber nicht bei Kulturkritik, bei Lob der Querulanz und Lifecoaching stehen. Sein Denken fand im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft statt. Man kann bei Nietzsche auch eine Kapitalismuskritik lesen, in der eine Freiheitsutopie schlummert. Sie fußt auf dem »Ideal-Hellenischen«, dem Menschen also, der all seine kreativen – intellektuellen, musischen, poetischen, athletischen usw. – Potentiale entfaltet. Die Griechen seien, schrieb er, und kann damit natürlich nur die Sklavenhalter, nicht aber die Sklaven meinen, die »wohlgeratenste, schönste, bestbeneidete, zum Leben verführendste Art der bisherigen Menschen«. Der freie, vollkommene, unentfremdete Mensch ist ganzheitlich: »Die Griechen waren keine Gelehrten, sie waren aber auch nicht geistlose Turner. Müssen wir denn«, klagt er, »so notwendig eine Wahl zwischen der einen oder andern Seite treffen, ist vielleicht hier auch durch das ›Christentum‹ ein Riß in die Menschennatur gekommen, den das Volk der Harmonie nicht kannte?«
Karl Kautsky knüpfte im Geist der Arbeiterbewegung an dieses Ideal an. Der bürgerliche Vorwurf, der Sozialismus werde die »Freiheit in der Arbeit« abschaffen, sei lächerlich, weil der Kapitalismus mit seiner Tendenz zum Großbetrieb dies selbst tue. Das Maschinenzeitalter aber schaffe das Potential der »Befreiung von der Arbeit«. Anders als im antiken Griechenland, wo das unfreie Leben der Sklaven die Voraussetzung des freien Lebens der Sklavenhalter war, sei dieses Leben nun für alle möglich: »Jene glückliche harmonische Bildung, die nur einmal in der Weltgeschichte bisher aufgetreten ist als das Vorrecht einer kleinen Schar auserlesener Aristokraten« werde »das Gemeingut aller Völker der Zivilisation werden; was für jene die Sklaven waren, werden für diese die Maschinen leisten (…). Glücklich jeder, dem es beschieden, seine Kraft einzusetzen im Kampfe für die Verwirklichung dieses herrlichen Ideals!«
Nietzsche, der zur selben Zeit schrieb, hätte genauso zu Kautskys Realutopie gelangen können. Zweifellos finden sich auch bei ihm kapitalismuskritische Aussagen: »Ehemals sah man mit ehrlicher Vornehmheit auf die Menschen herab, die mit Geld Handel treiben, wenn man sie auch nötig hatte; man gestand sich ein, daß jede Gesellschaft ihre Eingeweide haben müsse.« Nun aber seien »sie die herrschende Macht in der Seele der modernen Menschheit«. Dieser vermeintliche Antikapitalismus bleibt indes im Kulturpessimismus stehen, der bloß die Dominanz des schnöden »Mammons« bedauert. Aus Nietzsches Lamento spricht bloß das Ressentiment eines sich als platonischer Philosophenkönig Wähnenden, der aber nicht an der Spitze steht, wie es ihm qua Genius und »freiem Geist« zustehe.
Sklaven- und Herrenmoral
Wie Nietzsche den »Übermenschen« dachte, liegt die Welt, in der er Wirklichkeit wird, nicht jenseits, sondern diesseits der Grenzen des Kapitalismus. Kautskys Vision war die vom »Uebermensch (…) nicht als Ausnahme, sondern als Regel; ein Mensch, Uebermensch gegenüber seinen Vorfahren, aber nicht gegenüber seinen Genossen, ein erhabener Mensch, der seine Befriedigung nicht darin sucht, groß zu sein unter verkrüppelten Zwergen, sondern groß unter Großen, glücklich mit Glücklichen«. Für Nietzsche dagegen war das griechische Ideal nicht für alle verwirklichbar – und zwar nicht, weil er es für unrealisierbar hielt, sondern weil er jede Gleichheitsvorstellung abgrundtief hasste. Denn das Bild des »Übermenschen« kann nicht existieren ohne sein Gegenbild, den »Untermenschen«, der mit seiner Arbeit und dem von ihm geschaffenen Mehrwert den Lebensstil des »Übermenschen« erst ermöglicht. Nietzsches Herrenmoral existierte gar nicht, wenn sie nicht die Sklavenmoral als ihr Gegenbild besäße. Nietzsche lebt vom »Untermenschen«, ideell und materiell.
Nach Kautsky könnten dank der Steigerung der Produktivkräfte alle Menschen Menschen sein – sozialistische Persönlichkeiten. Aber genau dieses Szenario fürchtete Nietzsche wie nichts sonst, sah darin die »Bedrohung durch einen egalitären Totalitarismus«, dem – durch eine Politik der Vernichtung – »zuvorzukommen sei«.
Nietzsche schrieb darüber in seinen Überlegungen zum Genius, den er im Gegensatz zum »idealen Staat« sah: »Die Sozialisten begehren für möglichst viele ein Wohlleben herzustellen.« Aber »wenn der vollkommene Staat wirklich erreicht wäre, so würde durch dieses Wohlleben der Erdboden, aus dem der große Intellekt und überhaupt das mächtige Individuum wächst, zerstört sein«. Es ist die Welt des »letzten Menschen«, der in einer Welt der »Wärme«, des Vertrauens, des »achtsamen« Umgangs miteinander lebt, man »wird nicht mehr arm und reich: beides ist zu beschwerlich. (…) Jeder will das Gleiche, jeder ist gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.« Das, was für die (Lohn-)Sklaven also Utopie ist, ist für den Philosophen der Herrenmoral Dystopie, was ihr »Volksstaat« sein soll, ist für Nietzsche »Pöbelherrschaft«, was ihnen Sicherheit gegen den Markt bringen soll, ist für ihn Langeweile, was für die Lohnsklaven eine höhere Kulturstufe bringen wird, ist für Nietzsche das Ende der höheren Kultur.
Nietzsche wendete sich gegen den bloßen Humanismus, das Mitgefühl, das ihm als christliche Schwäche erschien. Das »warme, mitfühlende Herz« wolle »gerade die Beseitigung jenes gewaltsamen und wilden Charakters«. Die »höchste Intelligenz und das wärmste Herz« könnten »nicht in einer Person zusammen sein«, »Christus (…), den wir uns einmal als das wärmste Herz denken wollen, förderte die Verdummung der Menschen, stellte sich auf die Seite der geistig Armen und hielt die Erzeugung des großen Intellekts auf«. Der Staat, so Nietzsche in Anlehnung an Hobbes, sei »eine kluge Veranstaltung zum Schutz der Individuen gegeneinander«, übertreibe »man aber seine Veredelung«, so werde »zuletzt das Individuum durch ihn geschwächt, ja aufgelöst«.
Nietzsche steht politisch für Elitenförderung statt Bildung für alle, und er liefert bis heute, in seiner Wendung gegen die »Vergutmütigung« Europas, Futter für den rechten Kulturkampf gegen die »Gutmenschen«, »Gleichmacher« und »Woken«. Kurz: »Politisch ist er«, wie Wolfgang Fritz Haug richtig urteilte, ein »Reaktionär«.
In der Abwehr der Gleichheitsforderungen der Subalternen wurde Nietzsche autoritär. Sosehr er das Christentum auch kritisierte, war seine Denkbewegung »antichristlich maskierte synkretistische Religiosität«. Er beschrieb sich selbst als »verehrendes Tier«. »Jüngerschaft war ihm geläufig«, schrieb sein Biograph Werner Ross. Nietzsche wurde vom »drastisch autoritären Vater« unterworfen und immer wieder aufs »Örtchen« gezwungen, das in einer Strukturparallele zum einsamen Ort von Zarathustra »transfiguriert« wird, aber Nietzsche revoltierte nicht, sondern der Vater blieb »der absolute Schwarm des Jungen, der auf die Repression anscheinend durch Identifikation mit dem Repressor reagiert«. »Eine selbstbewußte, widerspenstige Natur von Kindesbeinen an, hatte er sich in die Naumburger Frauenherrschaft widerspruchslos gefügt, sich der Pfortaer Zucht widerstandslos unterworfen«, dann seinem akademischen Lehrmeister unterworfen, der ihn dann zu »einem Leben, dem Basler Lehrstuhl« verhalf.
Nietzsche war in seinem Leben dreimal Jünger: von Schopenhauer, dann Wagner, schließlich nur noch von sich selbst. Zum Ende seines Lebens stellte er sich selbst als »Der Gekreuzigte« dar und schied im Wahn, selbst Gott zu sein, aus dem Leben. Er glaubte, er könne die europäischen Monarchien in einer »antideutschen Liga« zusammenführen, um so Deutschland zu einem »Verzweiflungskrieg« zu zwingen, schrieb an den italienischen König als seinen Sohn und nannte den Quirinalspalast in Rom als seine Adresse. Als einsamer Stifter seiner eigenen Religion suchte er Jünger. Sein Ziel war es, »Mitschwärmer zu suchen und sie auf neue Schleichwege und Tanzplätze zu locken«, »Jünger eines noch ›unbekannten Gottes‹« – von ihm selbst.
Nietzsches Autoritarismus zeigte sich nicht nur in seiner Neigung zu rigidem, binärem Denken: Er sprach gern in Superlativen, seine Kopfschmerzen wollte er, wie so vieles, »mit Stumpf und Stiehl ausrotten«. Hinzu kommt: »Autoritäre Unterwerfung« unter Glaubenssysteme geht, wie Adorno beobachtete, mit »autoritärer Aggression« gegen die Nichteingeweihten einher, die »keinen besseren Sinn des Lebens« kennen als guten »Schlaf ohne Träume«. In Nietzsches Narzissmus steckte immer eine Bestrafungssehnsucht gegenüber den »Kranken und Absterbenden« – dieselbe autoritäre Aggression wie die des christlichen Fundamentalisten, der den Ungläubigen Feuerqualen androht.
Postmoderne Nietzscheaner
Wie konnte dieser autoritäre Antidemokrat, Antisozialist, Antiegalitarist und Antifeminist Nietzsche nun zum linken Referenztheoretiker werden? Brauchte es ihn zur Überwindung der Religion? Nein, der »Antichrist Nietzsches« sei unnötig, wusste schon Ernst Bloch. Er ist auch nicht der Zugangspunkt des zentralen linksnietzscheanischen Denkers: Michel Foucault, für den die »gerade entdeckte Begeisterung für Nietzsche« am Anfang seines Werks stand.
Den homosexuellen Foucault interessierte Nietzsches Wendung gegen die herrschende Moral, die von Fragen »gefährlicher Neugierde« ausging: »Kann man nicht alle Werte umdrehn?« Sie war verbunden mit dem Anspruch, eine grundsätzliche »Gegenwertung des Lebens, eine rein artistische, eine antichristliche« und »dionysische« erfunden zu haben. Nietzsche sah sein Werk als die »Geschichte der großen Loslösung«, »Wille zum freien Willen«, der ihm zum Schluss als »Wille zur Macht« erschien.
Diese Subjektaffirmation im Zusammenspiel mit Nietzsches Betonung, »daß der Mensch«, ja, »alles geworden ist«, es darum »keine ewigen Tatsachen« und auch »keine absoluten Wahrheiten«, sondern nur noch Perspektiven und subjektive Deutungen gibt, lässt sich in einen romantischen Voluntarismus, in ein Tatmenschentum überführen. Dieses kann sowohl rechts sein, wenn es als Subjekte hinter dem »Ereignis (mit) Größe« heroische Individuen – den »gewaltigen Mensch«, »Naturen wie Wagner« – erkennt, als auch links, wenn es an diese Stelle »Bewegungen von unten« setzt. Immer jedoch birgt es in seinem von den materiellen Wirklichkeiten abstrahierenden Idealismus und Avantgardismus – die »Welt als Wille und Vorstellung« – Extremistisches in sich.
Hier dockt der »postmoderne Linksnietzscheanismus« (Jan Rehmann) an. Ist die Ideologie einer Gesellschaft, ihre historisch gewordene Wertemoral bloß Diskurs, konstruiert, Ausdruck von »›Täuschungen‹, (…) Schein, Wahn, Irrtum, Ausdeutung, Zurechtmachung, Kunst«, dann ergibt sich die Option für den Voluntarismus einer »neuen Moral«. Der »erziehenden Umgebung«, die »jeden Menschen unfrei machen« wolle, »indem sie ihm die geringste Zahl von Möglichkeiten vor Augen stellt«, stellte Nietzsche die »vielen Möglichkeiten und Richtungen des Handelns« entgegen. Dies gilt auch in Bezug auf die Antimoral der Außenseiter: Wenn in der Gesellschaft Homosexualität kriminalisiert ist, manche sexuelle Praktiken als pervers betrachtet werden usw., das »Leben« aber »etwas essentiell Unmoralisches ist«, dann ist das Ziel Amoral, die »Umwertung der Werte«. Darum musste Foucault der Nietzsche-Satz wie Musik in den Ohren klingen: »Was bedeutet, unter der Optik des Lebens gesehn, – die Moral?« – »Einst hattest du Leidenschaften und nanntest sie böse. Aber jetzt hast du nur noch deine Tugenden: die wuchsen aus deinen Leidenschaften.«
Die Bedeutung von Nietzsches Denken mit seiner Affirmation eines moralbefreiten Begehrens für Foucault und die Schwulenbewegung, für Judith Butler und die Lesbenbewegung liegt auf der Hand: »Leib bin ich ganz und gar, und nichts außerdem.« Das »Größere« ist »dein Leib und seine große Vernunft, die sagt nicht Ich, aber tut Ich.« – »Das Selbst sagt zum Ich: ›hier fühle Lust!‹«. Darin liegt die magische Anziehungskraft des rechten Nietzsches auf seine linken Anhänger.
»Krankheit als Weg«
Das beantwortet auch die Frage danach, wer die Welt ändert. Für Nietzsche sind es die Genies, für den Linksnietzscheanismus sind es zwar deren Opfer, die aber selbst Geniehaftes in sich tragen.
Der Linksnietzscheanismus entstand in einer besonderen Epoche, dem »goldenen Zeitalter des Kapitalismus«, als Profite und Reallöhne zeitgleich stiegen. Für die akademische Neue Linke war die Arbeiterklasse ins System integriert, ja sogar selbst regressiv. Im Umkehrschluss sei die nötige Veränderung der Gesellschaft nur noch durch Randgruppen möglich. Bei Foucault, dem Historiker der Psychiatrien und Gefängnisse, sind es Schwule, psychisch Kranke und Häftlinge, bei Pier Paolo Pasolini sind es Schwule und Kleinkriminelle, bei Herbert Marcuse ist es die neue Bohème, sind es die Hippies, die die protestantische Arbeitsethik untergraben. Zu guter Letzt treten an die Stelle der Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt die nonkonformistischen Intellektuellen selbst.
Welch wundervolle Wendung der Geschichte hält Nietzsche also für sie und die Randständigen bereit: Politik in der ersten Person Singular. Nietzsches Schriften entfalten ihre narkotisierende Wirkung dadurch, dass der Leser sich schon allein dadurch, dass er den Seher und Künder absichtsvoll »verrätselter« Wahrheiten liest, sich zu den Auserwählten zählen darf. Verstärkt wird dieser Effekt dadurch, dass Nietzsche psychisches Leiden als den Ausdruck des Geniehaften feiert, »Krankheit als Weg«. Zweifellos kann Leiden eine immense Antriebskraft sein. Aber das Richtige, was in dieser Erkenntnis steckt, wirkt verheerend, wenn es Politik letztlich erst in dieser Form individualisiert, um dann ganz und gar hilflos die Vereinzelten als klassenlose Multitude zu beschwören.
Für Nietzsche sind »Achtung« des »Leibes« und »Verachtung« der »Verächter des Leibs« die »Brücke zum Übermenschen«. Das Private wird politisch, weil das Private zur Politik selbst wird – Selfcare ist plötzlich Revolution. Hedonistische Lebensführung wird zum Akt der Befreiung mit Beispielcharakter für die »Normalen«. An die Stelle einer Politik der Selbstbefreiung der Arbeiterklasse tritt die Politik der Selbstbefreiung des randständigen bürgerlichen Intellektuellen. Dies ist der Rückfall linker Politik zur »kritischen Kritik« des Linkshegelianismus, die hinausläuft auf: Wir »freien Geister« sind die Avantgarde, die euch den Weg weist, versammelt euch hinter uns. Eine Haltung à la »Wenn du dich nicht der linksradikalen Subkultur anschließt, bist du Teil des Problems«. Wenn jedoch die Jünger ausbleiben, schlägt diese Haltung wie beim alten Bruno Bauer in Geschichtspessimismus um, und die Massenverachtung kommt wieder zur Entfaltung.
Wie praktisch, dass mit Nietzsche die Sprache plötzlich als Mittel der Veränderung erscheinen kann, denn sie ist das Werkzeug der Intellektuellen, während der Streik das der Arbeiterklasse war. Der idealistische Ansatz, die Wirklichkeit über die Sprache ändern zu wollen, indem man gendersensible Sprache einführt, Karl May oder Astrid Lindgren umschreiben lässt und glaubt, damit die Gesellschaft ändern zu können, beruht auch auf Nietzsches betonter »Bedeutung der Sprache für die Entwicklung der Kultur«, die darin liege, »daß in ihr der Mensch eine eigene Welt neben die andere stellte«.
Abenteuerliche Rebellion
Der marxistische Philosoph Hans Heinz Holz sprach in einer fundamentalen Kritik von einer »abenteuerlichen Rebellion«. Nietzsche stand für ihn in einer Ahnenreihe »bürgerlicher Protestbewegungen in der Philosophie«, die mit dem radikalen Individualanarchismus von Max Stirner begann und sich über Nietzsche, Sartre und Marcuse bis zur Neuen Linken fortsetzte.
Die bürgerliche Rebellion, so Holz’ These, entspringt der Tendenz des Kapitals zu Konzentration und Monopolisierung. Aus der Kehrseite, des Verlustes der »Freiheit in der Arbeit«, die das alte Kleinbürgertum des 18. und frühen 19. Jahrhunderts geprägt habe, entstünde nun aus dem »Unbehagen der ihrer selbständigen gesellschaftlichen Rolle immer mehr beraubten kleinbürgerlichen Schichten« eine »Negation des Bestehenden (…), die auf nunmehr politisch entleerte Vorstellungen von der Freiheit und dem Selbstsein des Menschen, will sagen des Individuums, zurückgreifen, die aus der Aufstiegsperiode des Bürgertums entnommen werden«.
Ist, nach Marx, die Religion das »Opium des Volkes«, so ist Nietzsches Philosophie das Opium der Intellektuellen. Sein Glaubenssystem wirkt wie eine Droge. Für den Einsamen ist es Seelenbalsam und Gefängnis zugleich. Der Glaube gibt ihm Selbstwertgefühl, wo ihn die Mehrheit verachtet, aber er gibt es ihm durch Verachtung der Mehrheit. Dadurch führt es immer tiefer in Isolation hinein. Der Sektenführer tröstete seine Jünger, die »krankhafte Vereinsamung« als »Angelhaken der Erkenntnis« sei bloß ein Zwischenschritt zur »reifen Freiheit des Geistes«. Sein Versprechen ist strukturgleich zu dem der christlichen Lehre, gegen die er blind revoltierte: Das Diesseits ist ein Jammertal, aber hinter dem Horizont liegt die »Morgenröte«, die aber unerreichbar bleibt oder nur zum Preis der kritischen Elite als »geschlossene Masse« (Elias Canetti).
Am Ende bleibt es unentschlüsselbar: Führt die Einsamkeit zu Nietzsche oder Nietzsche zur Einsamkeit? Führt Minderwertigkeitsgefühl zu ihm oder er zu Überlegenheitsgefühl? Alles ist dialektisch verwickelt. Aber so wie Nietzsche von Schopenhauer, Wagner und sich selbst besoffen wurde, macht er andere trunken. Einen Nietzsche-Besoffenen erkennt man aus 100 Kilometer Entfernung. Man halte sich von ihm fern. Er wird einem nicht guttun – vor allem nicht, wenn man eine Frau ist.
Teil 1: »Hass auf die Masse« erschien in der Ausgabe der jW vom 23./24. August 2025.
Ingar Solty schrieb an dieser Stelle zuletzt am 18. Juli 2025 über Hitlers »Mein Kampf«: »Verkrachte Existenz«.
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Enrico M. aus Ottenhagen (25. August 2025 um 13:18 Uhr)Das Besondere an Friedrich Nietzsche ist der Anteil des Ersatzes mittels »lüsternem Gestreichel« (Peter Hacks) von verhinderter Sexualität als Philosophiemotor. Und folgt man Martin Heidegger, liegt die eigentliche Philosophie von F. N. im Nachlass (»Die nachgelassenen Fragmente, S. 266 (14[188])«): »Ewige Wiederkehr des Gleichen«. Aber auch das schon bei den Pythagoräern oder David Hume (Dialogues Concerning Natural Religion, S. 50) zu finden. Oswald Spengler benutzte diese Idee zur Erklärung von Weltgeschichte als immer wiederkehrendes Auf und Ab von Kulturen (»Der Untergang des Abendlandes« 1918). Georg Lukács hat das 1954 »Die Zerstörung der Vernunft« genannt. Soltys »Versuch« einer Erklärung für die für Nietzsche gehegte »unleugbare Anziehungskraft für linke Intellektuelle« mündet in der Behauptung, dessen »Affirmation eines moralbefreiten Begehrens« wäre ein Befreiungsruf »für … die Schwulenbewegung … und die Lesbenbewegung« gewesen. »Darin« läge »die magische Anziehungskraft des rechten Nietzsches auf seine linken Anhänger.« Einspruch. Schon Wolfgang Harich stritt gegen die Rehabilitierung von F.N. durch DDR-Linke (jW 16.03.2020 S. 12). Für diese (und viele andere immer noch linke Heteros) greift diese Erklärung naturgemäß nicht. Zweitens werden die Aussagen von Foucault und Butler unglücklich auf deren sexuelle Orientierung verkürzend begründet. Drittens die »Vernietzschung«: Ohne Nietzsche vermeintlich keine Frankfurter Schule (»überhaupt nicht zu denken«), kein Brecht, kein Sartre, keine »Psychologie als Wissenschaft«, kein Hermann Hesse, kein Degenhardt etc. Zu diesem »Segen« steht das Schlusswort im Widerspruch. Daneben sei hier an den Begriff der konvergenten Evolution erinnert: Das Fliegen wurde auch jeweils unabhängig voneinander bei Fledermäusen, Insekten, Vögeln und Pterosauriern »erfunden«. Für eine bestimmte Art von »Kulturkritik« liegt eine Analogie nahe. Bilanz: Der »postmoderne Linksnietzscheanismus« (Jan Rehmann) bleibt bei Solty ein Rätsel.
- Antworten
Ähnliche:
 Thierry Ehrmann18.01.2025
Thierry Ehrmann18.01.2025Das Gesetz im Pornoheft
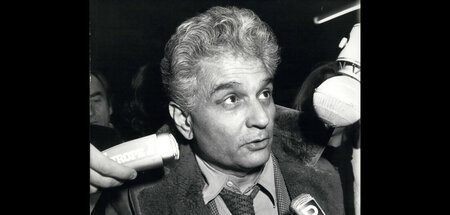 ZUMA/Keystone/imago12.11.2024
ZUMA/Keystone/imago12.11.2024Schuld und Sühne
 Zuma Keystone /stock&people/imago26.10.2021
Zuma Keystone /stock&people/imago26.10.2021Ein paar Fäden fehlen
