»auf den schaufeln von worten«
Von Florian Neuner
Jeder, der heute etwas an Poesie, oder etwas an Kunst macht, muss wieder bereit sein, sich anprangern und anspucken zu lassen. Ich meine das ganz im Ernst und ohne jede Scheu, auch wenn die Preise erst jüngst auf mich heruntergeschauert sind, ja gerade deswegen. Das lorbeergekrönte Haupt wird auf Dauer keinen entzücken.« Als Ernst Jandl das im Herbst 1984 in seinen Frankfurter Poetikvorlesungen dekretierte, die unter dem Titel »Das Öffnen und Schließen des Mundes« veröffentlicht wurden, hatte er gerade den Georg-Büchner-Preis, den prestigeträchtigsten Literaturpreis im deutschsprachigen Raum, entgegengenommen. Kurz zuvor, im März, war er mit dem Großen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet worden. Von den Vertretern der Nachkriegsavantgarde, den konkreten und experimentellen Dichtern, war und ist er der mit Abstand populärste. Den Büchner-Preis hatte aus diesem »Lager« zuvor erst ein einziger Autor bekommen – 1969 Helmut Heißenbüttel, von dem das Nachwort zu Jandls Band »Laut und Luise« stammt, mit dem er 1966 seinen literarischen Durchbruch schaffte. H. C. Artmann und die Jandl-Gefährtin Friederike Mayröcker wurden in Darmstadt erst viel später – eigentlich zu spät – ausgezeichnet, 1997 bzw. 2001, was Mayröcker für eine schreiende Ungerechtigkeit hielt und daraus auch keinen Hehl machte.
»Das Gedicht hat heute eine gute Zeit. Die größten Säle werden zu klein, wenn die Dichter aus ihren Verstecken hervorkommen, um ihre Gedichte vor Publikum zu lesen.« Diese optimistische Einschätzung, von Jandl vorgetragen bei der Entgegennahme des Großen Österreichischen Staatspreises, galt wahrscheinlich nur für ihn, der noch größere Säle füllte, wenn er gemeinsam mit Jazzmusikern wie seinem Freund Dieter Glawischnig, dem langjährigen Leiter der NDR-Bigband, oder mit Mathias Rüegg und dem Vienna Art Orchestra auftrat. Einige seiner Texte sind geradezu sprichwörtlich-populär geworden – so »lechts und rinks« und »ottos mops« – und wurden in Anthologien für Kinder gesammelt. Sie treten den Beweis an, dass eine modernistische, zeitgemäße Literatur nicht notwendig hermetisch oder esoterisch daherkommen und Zugangsbarrieren um sich errichten muss – auch wenn ein Autor wie der letztjährige Träger des Büchner-Preises Oswald Egger mit seinem so beliebigen wie prätentiösen, pseudoenigmatischen Neologismengeklingel derartige Vorurteile zu bestätigen scheint. Ganz anders Jandl: Bei ihm ist die Gemachtheit der Texte ausgestellt und kann als Einladung zum Mitspielen aufgefasst werden. Seine Popularität ist Jandl durchaus geneidet, seiner Literatur ein Zug ins Kabarettistische vorgeworfen worden – ein meist unberechtigter Vorwurf, resultieren die Pointen doch aus seiner konsequenten Handhabung des Materials.
Für jeden ein Golgatha
Der späte Ernst Jandl, der »Hiob in Wien« (Jörg Drews), wurde in der Schonungslosigkeit, mit der er die Malaisen des Alters, seine Depressionen und den Alkoholismus bis zum Selbsthass thematisierte, wahrscheinlich nur von Dieter Roth überboten, in dessen Dichtung sich nichts mehr pointensicher rundete. In Jandls Band »peter und die kuh«, der Gedichte aus den frühen 1990er Jahren versammelt, findet sich in dem Zyklus »kleines weihnachtsoratorium« etwa eine »kreuzigung«: »ich scheiß mich an / es rinnt die bein hinunter / und ich geh ganz blass / durch die wohllebgass«. Nach der Schilderung der Rückkehr in die Wohnung, die nicht vonstatten geht, ohne dass »auf den schönen stufen« Spuren zurückbleiben, endet das Gedicht mit dem Vers: »ich halte beschissenes beinkleid / geeignet für den müll / worauf ich mich mit wein / bis stimmungsumschwung füll.«
Das Spätwerk, das der Autor sich zwischen langen Phasen der Unproduktivität abrang, tat seiner wachsenden Beliebtheit keinen Abbruch, auch wenn diese Altersgedichte niemals populär wurden. In den 1990er Jahren, als der Stern der experimentellen Literatur schon stark im Sinken war und die großen Verlagshäuser die Förderung einstellten, avancierte Jandl zum Star. Der Titel »kreuzigung« in dem späten Zyklus kommt nicht von ungefähr – Jandls Texte sind durchzogen von Blasphemien. »oh scheiße, ich habe gestern / mein abendgebet vergessen / aber heut früh wirst du es, lieber gott / auch noch akzeptieren // ›lieber gott, laß mich eher sterben / als eine todsünde begehen‹« heißt es in einem anderen Abschnitt des »weihnachtsoratoriums«. Nun werden aber zwei »Todsünden« begangen, statt die Messe zu besuchen, wird im Bett onaniert: »seltsam, wie oft / er mein gebet schon nicht erhört hat.«
Eine volle Breitseite katholischer Bigotterie bekam Ernst Jandl von seiner früh verstorbenen Mutter Luise ab, was aber zu keiner konsequenten Abwendung von der Religion führte. Aus der katholischen Kirche ist Jandl nie ausgetreten, und er wurde auch wunschgemäß mit einem Rosenkranz in Händen im Wiener Ehrengrab bestattet. Der Biograph Hans Haider unterstellt ihm, eine Aussöhnung zwischen Katholizismus und Sozialdemokratie angestrebt zu haben; in einer »Rede auf Friederike Mayröcker« sagte Jandl 1994: »Wir sind Christen, ein Wort, das man heute wieder aussprechen darf.«
In einer autobiographischen Skizze schrieb er 1978 über seine Mutter: »Ihre acht Jahre währende, zum Tode führende Krankheit, Myasthenia gravis, steigerte nicht nur ihre Religiosität ins – wie mir damals schien – Maßlose, sondern ließ sie auch mit dem Schreiben beginnen.« Ein Gedicht der Verstorbenen ließ der Witwer Viktor Jandl auf die Rückseite eines Gedenkbildchens drucken. Es beginnt so: »Wir wandern weh, wir wandern still, / Wir wandern so, wie Gott es will. / Die Erden ist hart, das Leid ist nah – / Für jeden gibt es ein Golgatha.«
Rigoroser Antifaschist
Am 1. August 1925 als Sohn eines Bankangestellten in Wien geboren, zeigte Ernst Jandl schon als Schüler literarisches Talent. Als Soldat der deutschen Wehrmacht erlebte er die scheiternde Ardennen-offensive an der Westfront und geriet in US-amerikanische Kriegsgefangenschaft. Seine Englischkenntnisse waren gefragt und er wurde fast ein Jahr lang als Dolmetscher im englischen Stockbridge eingesetzt. Das Englische wurde für den anglophilen Jandl die »Sprache der Freiheit«, der Jazz die dazu passende Musik. Dass seine Jazzbegeisterung politische Gründe hatte, hob Jandl gerne hervor. Ich erinnere mich an ein Podiumsgespräch in Wien, bei dem er apodiktisch behauptete, dass man die Musik von Mozart und Beethoven nach ihrem Missbrauch in der NS-Zeit nicht mehr hören könne – und heftigen Widerspruch des damaligen Berliner Akademiepräsidenten Walter Jens erntete. In einem in der Zeitschrift neue texte abgedruckten Gespräch mit Peter Weibel berichtet Jandl davon, wie ihn die von den Nazis propagierte Kunst gelangweilt habe: »es ist ein kindheits- und jugenderlebnis, die kunst als spiegel einer unzerstörten heilen welt als etwas unerträgliches zu sehen, und ich war damals unerhört gierig auf alles, was kunst auf eine andere weise gezeigt hat, also sagen wir dissonanzen in der musik, ein möglichst krasses verändern der sprache und ein möglichst krasses verändern der bekannten gesehenen welt im bild, und dann natürlich auch die ungegenständliche malerei.« Und Jandl bekannte: »ich sehe die welt nicht als eine fehlerfreie welt, und ich bin auch nicht ein utopist, der eine schöne neue welt entwerfen will mit dem, was er schreibt.«
In seinem Text über Ernst Jandl in dem Band »Österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts« (Berlin: Volk und Wissen 1988) attestierte Klaus Pankow dem Dichter aus Wien ein »demokratisches Verantwortungsbewusstsein, getragen von einem rigorosen Antifaschismus« und billigte ihm das Verdienst zu, »den auf Systemstabilisierung gerichteten Kunstbetrieb entlarvt und produktive literarische Verfahren aus vergessenen und weithin verdrängten Traditionen entwickelt« zu haben. Er setzte aber einschränkend hinzu, dass daraus »zu keinem Zeitpunkt eine gesellschaftsumwälzende Funktion« abgeleitet werden konnte.
Dass er 1974 Reiner Kunze einen österreichischen Preis verschaffte, musste Jandl für die DDR-Kulturbürokratie zunächst suspekt erscheinen lassen, 1981 erschien aber ein erster Gedichtband bei Volk und Welt (»Augenspiel«), und Jandl wurde im selben Jahr von Stephan Hermlin zur »Berliner Begegnung« eingeladen. Seit 1986 war er nicht nur Mitglied der Westberliner, sondern auch der Ostberliner Akademie der Künste, gern gesehener Gast nicht nur im Theater im Palast, sondern auch im literarischen Underground des Prenzlauer Bergs. Er erkannte das außerordentliche Talent von Bert Papenfuß – für Jandl ein »Dichter, der die Düsterkeit unseres historischen Augenblicks in Versen von hoher Qualität festhält, einschneidend und herausfordernd wie experimentelle Poesie«.
Dass Ernst Jandl ein rigoroser Antifaschist und Pazifist war, duldet keinen Zweifel. Und doch sind seine frühen Gedichte noch kein schroffer Bruch mit der literarischen Tradition. Wie in den Texten der Autoren der Gruppe 47 wird eine historische Zäsur zwar thematisiert, aber noch nicht ästhetisch umgesetzt, wenn Jandl in einem »Zeichen« überschriebenen Gedicht formuliert: »Zerbrochen sind die harmonischen Krüge, / die Teller mit dem Griechengesicht, / die vergoldeten Töpfe der Klassiker – // aber der Ton und das Wasser drehen sich weiter / in den Hütten der Töpfer.«
Das Gedicht ist enthalten in Jandls erstem Gedichtband »Andere Augen« aus dem Jahr 1956, der kein großes Aufsehen erregte und mit dem der Autor sich auch noch nicht als Exponent der Avantgarde positionierte. Da waren die Autoren der Wiener Gruppe um H. C. Artmann und Gerhard Rühm schon weiter, die sich auch in Bohème- und Dandyposen übten, während Jandl ein Lehramtsstudium in den Fächern Deutsch und Englisch absolvierte, alsbald in den Schuldienst eintrat und eine Studienkollegin ehelichte.
Noch zu seinem traditionellen Frühwerk rechnet auch das »Zehn-Jahre-Pamphlet«, mit dem er sich gegen die Wiederbewaffnung des in die Unabhängigkeit entlassenen Österreich wendete: »(…) zehn Jahre sind eine lange Zeit / und den meisten wird in zehn Jahren so viel egal / dass wir beginnen können, ein neues Heer aufzubauen / aus den Söhnen der gleichen Männer, die vor zehn Jahren / Uniformen verbrannten, Gewehre zerschlugen, den Krieg verfluchten und sagten: uns / bringt nie wieder einer zum Militär, / denn ein Militär ist das Werkzeug zum Krieg.«
»schtzngrmm«
Wenige Jahre später wird Jandl eine ästhetische Kehrtwende vollzogen haben und seine Anklage des Militarismus als »Sprechgedicht« in die Welt schreien: »schtzngrmm / schtzngrmm / t-t-t-t / t-t-t-t / grrrmmmmm / t-t-t-t / s---------c---------h«. »schtzngrmm« hatte Jandl auch bei seinem legendären Auftritt in der Royal Albert Hall in London im Juni 1965 auf dem Programm, wo er unter anderem mit Allen Ginsberg Teil der »International Poetry Incarnation« war. Mit seiner »eher harten, im Bereich des tieferen Blechs liegenden Stimme, die jeder Nachtclub-Süsslichkeit vollkommen unfähig ist« (Jürg Laederach) überwand er als Performer mühelos die Sprachgrenzen. Noch bevor diese Arbeiten in Buchform verfügbar waren, war Jandl Teil der Internationale der konkreten, visuellen und Lautpoesie, die in Zeitschriften und Ausstellungen regen Austausch pflegte; für die Zeitschrift neue texte stellte er 1969 ein Heft mit konkreter Poesie aus Großbritannien zusammen.
In den Frankfurter Poetikvorlesungen arbeitet er heraus, wie sich diese neue Poesie von den Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts herschreibt – und von konservativen Kritikern deshalb oft als »Neo-Dada« verspottet wurde: »Es bedurfte einer neuen literarischen Revolution, die zu Beginn der fünfziger Jahre an verschiedenen Punkten der Welt gleichzeitig und viel stiller begann als etwa Dada, der 1916 mit voller Lautstärke einsetzte, nämlich der Konkreten Poesie, um die Anfänge der neuen Dichtung wiederzuentdecken, sich zu ihnen zu bekennen und sie erneut an die Öffentlichkeit zu bringen.«
Mit den Autoren der Wiener Gruppe hatte sich längst ein reger Austausch ergeben, aber richtig dazu gehörten Jandl und seine Gefährtin Mayröcker nicht. »Mich haben die Kerle nicht eingeladen«, beklagte er sich einmal, angesprochen auf die legendären »literarischen cabarets« der Kollegen. Während »die Kerle« ihre Privatanarchie pflegten und öffentlich ein Klavier zerhackten, litt Jandl zunehmend am Schuldienst, der ihm nicht selten die Teilnahme an Veranstaltungen verunmöglichte.
In seinem Jandl-Buch, das der österreichische Feuilletonist und Jandl-Weggefährte Hans Haider eine »konkrete Biographie« nennt und das leider eine Unmenge an Druckfehlern und nicht wenige sachliche Fehler enthält, kann man minutiös – von Haider nicht ohne Süffisanz präsentiert – nachvollziehen, wie Jandl es sich immer besser richten konnte. So konnte er auf seinen in der Schulverwaltung tätigen Freund Franz Austeda bauen, der immer wieder Auszeiten und Beurlaubungen – etwa für ein DAAD-Stipendium in Westberlin – und schließlich die Frühpensionierung ermöglichte. Zu dieser Zeit hatte Jandl längst ein zeitraubendes kulturpolitisches Engagement entfaltet. Das Unterrichtsministerium registrierte, »dass die Kollision zwischen Unterricht und schriftstellerischer Arbeit, nicht aber zwischen Verwaltungstätigkeit und schriftstellerischer Tätigkeit zu depressiver Erkrankung« führt.
Ernst Jandl war ein in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat und Gewerkschafter, der im »roten Wien« die Strippen zu ziehen wusste. Als die SPÖ unter Bundeskanzler Bruno Kreisky ab 1970 allein regierte, eröffneten sich in der Kulturpolitik auf Bundesebene neue Chancen. Waren Jandl und seine Freunde von der Wiener Gruppe vorher von staatlicher Kulturförderung ausgeschlossen gewesen – was Artmann, Rühm und Oswald Wiener zur Auswanderung bewog – und auch im Rundfunk nicht zum Zug gekommen, änderte sich das nun schlagartig, und sie hatten das Ohr von Ministern.
Abgesicherte Revolte
Als Alexander Lernet-Holenia, der Präsident des von alten Nazis und katholischen Reaktionären durchsetzten österreichischen PEN-Clubs, 1972 aus Protest gegen die Vergabe des Nobelpreises an Heinrich Böll zurücktrat, war ein günstiger Zeitpunkt für eine Gegengründung gekommen: die Grazer Autorenversammlung (GAV), von Jandl maßgeblich angeschoben – nicht ohne diese »Revolte« zuvor im Ministerium mit Subventionen abzusichern. Es ging um die kulturelle Hegemonie, und zweifellos ist Jandl und Konsorten nicht nur ein entscheidender Modernisierungsschub zu verdanken, sondern auch Verbesserungen in der sozialen Absicherung österreichischer Künstler; lange war Jandl selbst im Sozialfonds der Literarischen Verwertungsgenossenschaft tätig.
Dass an die Stelle der alten, konservativen Strippenzieher nun eben neue getreten waren, ist nicht zu leugnen, und so hat Jandl etwa bei jeder sich bietenden Gelegenheit seine Lebensgefährtin Mayröcker ins Spiel gebracht – in Thomas Bernhards Skandalbuch »Holzfällen« karikiert als »Anna Schreker«: »Aber nicht nur die Schreker (und ihr Lebensgefährte) und die Billroth machen sich seit Jahrzehnten fortwährend auf die niederträchtigste Weise gemein in diesem Land mit allen sogenannten Staatsgeld und Staatsehren verwaltenden Leuten, mehr oder weniger alle österreichischen Künstler gehen, sobald sie, wie gesagt wird, in die Jahre gekommen sind, diesen Weg, verleugnen alles, das sie bis fünfundzwanzig oder dreißig mit der größten Entschiedenheit und mit der größten Lautstärke sozusagen als die notdürftigste Moral des Künstlertums hochgehalten und propagiert haben, wo immer, und verbrüdern sich mit den staatlichen Geld- und Ordens- und Rentengebern.«
Der Biograph Hans Haider vermutet, dass Jandl die Privilegien, die in den sozialistischen Ländern verdienten Staatskünstlern zugestanden wurden, als vorbildlich ansah. Jedenfalls war Jandl ein gewisses Anspruchsdenken nicht fremd. Kurz vor seinem Tod am 9. Juni 2000 erreichte er, zeitlebens von beengten Wohnverhältnissen geplagt, immerhin, dass auf Staatskosten Wohnungen für ihn und Friederike Mayröcker angekauft wurden. Im Wahlkampf dichtete er für den SPÖ-Bürgermeister Helmut Zilk (»du schönes wien, auf zilk gebaut!«). Nach dem Tod von Erich Fried schuf sich Jandl, der stets bieder und korrekt gekleidet wie der Prototyp eines Beamten auftrat, mit der Erich-Fried-Gesellschaft eine Spielwiese, die es ihm erlaubte, Freunde mit Preisen zu bedenken und alte Weggefährten wie Hans Mayer um sich zu scharen.
Der Dichter aber blieb bis in die letzten Jahre, als ihn zunehmend Depressionen und Schreibkrisen lähmten, skeptisch, selbstkritisch und poetologisch beweglich. Konkrete Poesie hätte er bis an das Ende seiner Tage schreiben können – andere haben es getan –, aber Jandl erkundete Neuland und entdeckte in den 1970er Jahren für sich die »heruntergekommene Sprache«, laut Klaus Pankow eine depravierte Sprache, »die aus der Kombination von verfremdetem ›Gastarbeiterdeutsch‹, österreichischen Dialektbrocken und generell gestörter Syntax, vor allem fehlender oder / und fehlender Flexion entsteht«: »schreiben und reden in einen heruntergekommenen sprachen / sein ein demonstrieren, sein ein es zeigen, wie weit / es gekommen sein mit einen solchenen: seinen mistigen / leben er nun nehmen auf den schaufeln von worten / und es demonstrieren als einen den stinkigen haufen / denen es seien.«
»Die Macht der heruntergekommenen Sprache« gibt Jandl die Möglichkeit, in dem 1976 beim »Steirischen Herbst« in Graz uraufgeführten Konversationsstück »die humanisten« das konservative Kulturestablishment zu attackieren, gegen das er die GAV gründete und kulturpolitisch agitierte. Zwei Nobelpreisträger, ein Professor und ein Künstler, treffen aufeinander und bestärken sich gegenseitig in ihrem Chauvinismus: »in kunst viel nicht gut sein / heut in kunst viel nicht gut sein / deutsch sprach sein kunst / sein ein kunstsprach / vaterland sein kunst / vaterkunstland / kunstvaterland … / viel kunst heut nicht gut sein / viel kunst heut nicht viel gut sein / sein viel – schmutzen / kunst schmutzen / sein viel viel schmutzen / viel viel kunst-schmutzen«.
Seinen größten Bühnenerfolg feierte Jandl aber mit der Sprechoper »Aus der Fremde«, die nach der missglückten Grazer Uraufführung 1979 über viele deutsche Bühnen wanderte. Brutal autobiographisch monologisiert hier ein alternder, depressiver, trinkender Autor, trifft seine Gefährtin und einen jungen Freund und bleibt schließlich wieder allein in seiner Wohnung zurück. Jandl wendet den Kunstgriff an, die Protagonisten in der dritten Person von sich und im Konjunktiv sprechen zu lassen, strukturiert in Dreizeilern: »sein einziges kapital / die zeit / wie er es vergeude // aber er habe sich / nicht gewünscht / in diese welt // leben und hirn / solle man nicht / kombinieren.«
Leere Zeit verstreicht
Der Erfolg seines Dreipersonenstücks erzeugte eine Nachfrage an neuen Stücken, die Ernst Jandl nicht befriedigen konnte. Es widerstrebte ihm, Konzepte zu Tode zu reiten oder zu schreiben, wenn er keine zündende Idee hatte, einen »Motor«, wie er sich ausdrückte. So erging es auch dem Hörspielautor Jandl, der Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre eine wichtige Rolle im Neuen Hörspiel hatte. Als das Stereohörspiel noch neu war, schrieb er gemeinsam mit Friederike Mayröcker das 19 Minuten kurze, preisgekrönte Hörspiel »Fünf Mann Menschen« (SWF 1968), in dem Menschenleben schablonenhaft von der Gebärklinik bis zur Erschießung durchexerziert werden. Jandl und Mayröcker kamen in Kontakt mit Klaus Schöning, dem Präzeptor des Neuen Hörspiels beim WDR in Köln, produzierten weitere Stücke in Kooperation und allein. Während seine Freundin noch Dutzende, oft arg kunstgewerbliche Hörstücke produzierte, an denen sie nicht selten auch selbst mitwirkte, führte Jandl das Genre bereits 1971 mit »Der Uhrensklave« (SDR) an einen Nullpunkt: Das Verstreichen der Zeit als solches wird thematisiert, beliebige Texte aus Tageszeitungen dienen als sprachliches Material.
Das leere Verstreichen der Zeit wird auch in dem Gedichtband »selbstporträt des schachspielers als trinkende uhr« (1983) dargestellt: »das glas / mit gin tonic / und dem mülheimer stadtwappen / zur erinnerung an eine / große stunde / fülle er alle 25 minuten / und nehme daraus / alle 4 bis sieben / minuten / gerade einen schluck. / alle zwölf / bis 14 minuten / entzünde er / eine zigarette. / so errichte er / die background-struktur / für sein heutiges gedicht.«
Einen ergiebigen »Motor« für die Gedichtproduktion fand Jandl noch einmal Anfang der 1990er Jahre mit seinen »stanzen« – »Gstanzln«, Vierzeiler in Mundart, resignativ und deftig, die er auch im Duett mit dem Akkordeonisten Erich Meixner vortrug: »i scheiss da in d’bappm / und du deafst as schlickn / daun scheissd du marin mei bappm / und i deaf dron dastickn«.
Hans Haider berichtet, dass Jandl spätnachts und alkoholisiert gerne telefonisch Telegramme aufgab, mit denen er aus allen möglichen Anlässen (kultur-)politisch intervenierte. So sendete er 1991, kurz vor Ausbruch des Golfkriegs, an den Wiener Kardinal Hans Hermann Groër einen so rührenden wie verzweifelten Friedensappell: »Wir bitten Sie, in diesen Tagen der höchsten Kriegsgefahr das Heer der katholischen Österreicher und Österreicherinnen, die nicht mehr im Glauben an Gott leben und die nicht mehr gewohnt sind zu beten, in sämtlichen Medien eindringlich dazu aufzurufen, in unsere Kirchen zu kommen und dort gemeinsam mit ihren Brüdern und Schwestern, den praktizierenden Katholiken, an die Erhaltung des Weltfriedens zu denken. Dieses Denken wird sich von einem Beten um Frieden kaum unterscheiden.«
Florian Neuner schrieb an dieser Stelle zuletzt am 24. Oktober 2024 über Anton Bruckner: »Komponist als Ärgernis«.
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ähnliche:
- 26.03.2025
»Wer Lenin gelesen hat, weiß eben mehr«
 -/picture alliance13.03.2025
-/picture alliance13.03.2025»Sieh was ist. Frag wie es kam«
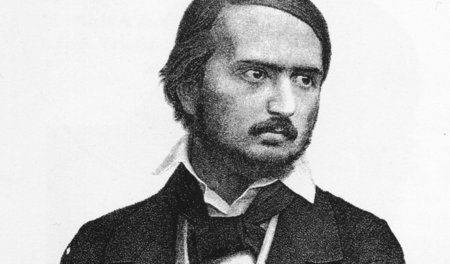 Georg Herwegh-Edition31.05.2017
Georg Herwegh-Edition31.05.2017Sänger der Freiheit
