Unschärfe als Waffe
Von Michael Henkes
In Franz Josef Degenhardts Lied »Befragung eines Kriegsdienstverweigerers« verweist der Protagonist gegenüber einem Beamten auf sein im Grundgesetz verbrieftes Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Dieser reagiert empört: »Also Sie berufen sich hier pausenlos aufs Grundgesetz – sagen Sie mal, sind Sie eigentlich Kommunist?« Tatsächlich waren sich Kommunisten und andere progressive Kräfte in der BRD der begrenzten Wirkung des bürgerlichen Rechts immer bewusst. Doch wo nötig, beriefen sie sich darauf und waren auch bereit, es gegen die Angriffe derjenigen zu verteidigen, die es in Sonntagsreden predigten. Umgekehrt sind nicht wenige Teile des Bürgertums bereit, das Recht zu ignorieren oder zu schleifen, wann immer es ihnen nutzt. Dafür gibt es etliche Beispiele, sei es aus dem Kaiserreich, der Weimarer Republik oder auch aus jüngster Zeit – Stichwort Versammlungsrecht. Mit dem am 19. September 1950 erlassenen Beschluss der Bundesregierung unter Konrad Adenauer (CDU) reihte sich in der frühen BRD ein weiterer Fall ein.
Die später als »Adenauer-Erlass« bekannt gewordene Anordnung selbst fügte dem bundesrepublikanischen Recht kein weiteres Gesetz hinzu. Sie berief sich vielmehr auf das bestehende Deutsche Beamtengesetz, das ein Bekenntnis der Staatsdiener zur demokratischen Staatsauffassung voraussetzt. So weit, so selbstverständlich: Das Beamtentum ist immanenter Teil des Staatsapparates. Der Staat ist zur Aufrechterhaltung seiner Ordnung auf die Treue oder zumindest nicht aktive Gegnerschaft seiner Beamten angewiesen. Dies vorausgesetzt, erscheint es wenig verwunderlich, dass die Bundesregierung eine »Feindesliste« verabschiedete und in ihr insgesamt dreizehn Organisationen auflistete, die dieser Ordnung gegenüber feindlich und entsprechend ihre Mitglieder vom Staatsdienst auszuschließen seien. Doch ist das Recht kein statisches, metaphysisches Ding, das über den politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen schwebt, sondern zugleich deren Ausdruck. An seiner Ausgestaltung und Anwendung zeigen sich die Kräfteverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft. So lohnt ein detaillierterer Blick auf den Erlass.
Hauptfeind steht links
In dem Beschluss heißt es: »Wer als Beamter, Angestellter oder Arbeiter im Bundesdienst an Organisationen oder Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Staatsordnung teilnimmt, sich dafür betätigt oder sie sonst unterstützt (…), macht sich einer schweren Pflichtverletzung schuldig.« Es fällt auf, dass hier nicht auf das Grundgesetz im Besonderen, sondern auf die nicht näher bestimmte »freiheitliche demokratischen Staatsordnung« rekurriert wird. Dieses Argument wurde Teil einer »Rechtstradition«, in der – spätestens mit dem Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) 1952 – stets auf die »freiheitliche demokratische Grundordnung« (FDGO) als Prüfstein verwiesen wurde.
Fortan wurde die angebliche Feindschaft gegen die schwammig gehaltene FDGO zur allgemeinen Begründung für ein rigoroses Vorgehen gegen politische Gegner. Wo dieser Gegner steht, das wird klar nach einem Blick auf die dem Erlass zugehörige Liste von Organisationen. Zwei von ihnen lassen sich der politischen Rechten zuordnen: die SRP, eine Sammelpartei für Nazis, die den Weg in die neuen bürgerlichen Parteien nicht nehmen wollten oder konnten, und die »Schwarze Front«, eine dem Otto-Strasser-Flügel der NSDAP vergleichbare Organisation.
Die restlichen elf – und damit die überwältigende Mehrheit – der genannten Organisationen zählen zur marxistischen und allgemein antimilitaristischen, antifaschistischen Linken oder standen einfach nur in Kontakt mit der DDR: KPD, Sozialdemokratische Aktion, Freie Deutsche Jugend (FDJ), Vereinigung der Freunde der Sowjetunion, Gesellschaft zum Studium der Kultur der Sowjetunion, Kulturbund zur demokratischen Erneuerung, Gesamtdeutscher Arbeitskreis für Land- und Forstwirtschaft, Komitee der Kämpfer für den Frieden, Komitee junger Friedenskämpfer und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN). Sie alle standen dem Aufrüstungs- und Westbindungskurs der Adenauer-Regierungen sowie der kapitalistischen Restauration und der Einbindung von Faschisten in den Staat feindlich gegenüber. Ob damit auch eine Feindschaft gegenüber demokratischen Grundprinzipien einherging oder nicht vielmehr deren Verteidigung, gar Weiterentwicklung – das müsste zumindest Gegenstand auch bürgerlicher juristischer Diskussionen sein. Ebenso in Frage steht, ob überhaupt eine Institution abseits des Bundesverfassungsgerichts die Verfassungsfeindlichkeit einer Organisation feststellen darf.
Opposition ersticken
Die Adenauer-Regierung schenkte solchen Diskussionen keine Beachtung. Ihr war klar, wo der Feind steht. Nützlich war ihr vor allem die bewusst schwammig gehaltene Formulierung der »Betätigung« für und »Unterstützung« der genannten Organisationen. Ist die KPD ein Feind der FDGO, weil sie gegen die Remilitarisierung auftrat? Ist man Unterstützer der KPD, wenn man bei einer Flugblattverteilung eines ihrer Blätter annahm? Betätigt man sich für die FDJ, wenn man eine Petition unterschreibt, die auch von dieser mitgetragen wurde? Ist Feind der FDGO, wer sich gegen NATO und Wiederbewaffnung ausspricht, nur weil es auch die Kommunisten tun?
Der »Adenauer-Erlass« war Teil der Auseinandersetzung um die Ausrichtung Westdeutschlands im Kalten Krieg. Zu dem Zeitpunkt des Beschlusses waren einige Grundpfeiler – etwa die Restauration der kapitalistischen Ordnung (»Soziale Marktwirtschaft«) oder die Teilung Deutschlands – schon gesetzt. Andere waren dagegen noch ein offenes Kampffeld, sei es die Frage der Wiederbewaffnung, der NATO-Mitgliedschaft oder die nach der ökonomischen Mitbestimmung der Werktätigen. In breiten Teilen der Bevölkerung, insbesondere in den Gewerkschaften, stießen die Adenauer-Regierung und die hinter ihr stehenden Westmächte auf Ablehnung. Der Antikommunismus in Wort, Tat und Gesetz war ein nützliches Instrument, um diese Opposition niederzuringen. Entsprechend verwundern die auf den Adenauer-Erlass folgenden juristisch-politischen Angriffe nicht. Es folgten unter anderem 1951 die Änderung des Strafrechts, die den Bereich der Gegnerschaft zur FDGO nochmals ausweitete, das Verbot der Volksbefragung zur Wiederbewaffnung, das FDJ-Verbot von 1951, das KPD-Verbot von 1956 und der Radikalenerlass von 1972. Es verwundert auch wenig, dass das quantitative Verhältnis eine klare Sprache spricht: Von 1951 bis 1968 wurden circa 7.000 Urteile gegen Kommunisten gefällt; im gleichen Zeitraum aber nur 1.000 gegen Rechte. Die Zehntausenden Ermittlungsverfahren, Befragungen, de facto Berufsverbote etc. sind hier noch nicht mitgerechnet.
Jegliche Unterstützung wird kriminalisiert
Die Gegner der Bundesrepublik verstärken ihre Bemühungen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu untergraben. Jede Teilnahme an solchen Bestrebungen ist unvereinbar mit den Pflichten des öffentlichen Dienstes. Alle im unmittelbaren oder mittelbaren Bundesdienst stehenden Personen haben sich gemäß Pargraph 3 des vorläufigen Bundespersonalgesetzes durch ihr gesamtes Verhalten zur demokratischen Staatsordnung zu bekennen.
(…)
Die Bundesregierung ersucht die Dienstvorgesetzten, gegen Beamte, Angestellte und Arbeiter, die ihre Treuepflicht gegenüber der Bundesrepublik durch Teilnahme an solchen Organisationen oder Bestrebungen verletzen, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
(…)
Der Beschluss der Bundesregierung stellt klar, dass die Teilnahme von Beamten, Angestellten und Arbeitern im unmittelbaren und mittelbaren Bundesdienst an Bestrebungen oder Organisationen, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtet sind, mit der Treuepflicht gegen die Bundesrepublik nicht vereinbar ist. Darunter fallen in gleicher Weise links- und rechtsradikale Bestrebungen oder Organisationen. Die Aufzählung der Organisationen ist nicht erschöpfend. Untersagt ist jede Teilnahme, Betätigung oder Unterstützung. Damit ist auch die Mitgliedschaft untersagt; denn bereits die geldliche Stärkung einer Organisation durch Beitritt bedeutet eine Unterstützung.
Beschluss der Bundesregierung vom 19. September 1950
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besondere Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Ralph D. aus Gotha (15. September 2025 um 15:11 Uhr)Dem Erlass der Bundesregierung folgte bereits ein Jahr später das sogenannte »Blitzgesetz«, jenes erste Gesetz zur Verschärfung des Strafrechts, welches seinen Namen dadurch erhielt, weil es Adenauer wie ein Blitz durchs Parlament peitschen ließ. Es bildete letztlich die Grundlage für eine dann einsetzende maßlose Kommunistenverfolgung und -kriminalisierung, der Tausende, zum Teil auch nicht der Partei angehörende Demokraten, zum Opfer fielen. Sie fand letztlich erst mit der Liberalisierung des politischen Strafrechts in der Bundesrepublik im Jahre 1968 ihr Ende. Da war Adenauer ein Jahr tot. Er hatte das Feindbild des Antikommunismus wiederbelebt und war davon geradezu besessen. Ralph Dobrawa, Gotha
-
Leserbrief von Reinhard Hopp aus Berlin (13. September 2025 um 09:50 Uhr)In der Adenauer-Ära konnten die alten Naziverbrecher ihre Karrieren unbehelligt und in ihrem Sinne weiterhin erfolgreich fortsetzen; vor allem Juristen und Mediziner. In dem Adenauer-Kabinett von 1949 gab es mehr Nazis als in der Hitler-Papen-Regierung von 1933. Die Folgen der braunen Adenauer-Politik wirken noch bis in die Gegenwart dieses Landes spürbar nach. Eine »Entnazifizierung« hat nur auf dem Papier (»Persilscheine«) stattgefunden, nicht aber in der Realität.
Ähnliche:
 Sorsche/Jaeger/picture alliance / ASSOCIATED PRESS07.09.2024
Sorsche/Jaeger/picture alliance / ASSOCIATED PRESS07.09.2024Bonn tagt
 Anton Tripp11.09.2017
Anton Tripp11.09.2017Eindeutig verfassungswidrig
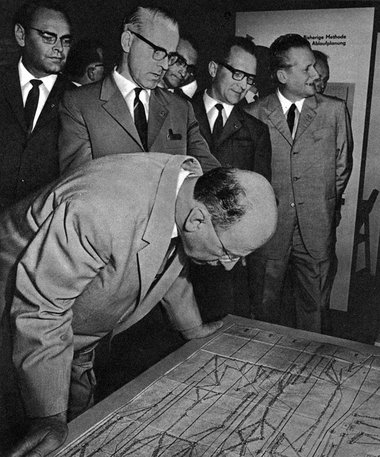 jW-Archiv25.06.2013
jW-Archiv25.06.2013Schöpferischer Mensch
Mehr aus: Geschichte
-
Anno ... 38. Woche
vom 13.09.2025
