In die Separation geführt
Von Reinhard Lauterbach
Der Winter 2013 verlief im Donbass und den anderen Industriegebieten der Süd- und Ostukraine ruhig, anders als in Kiew, wo liberale und rechte Kräfte versuchten, den Sturz des 2010 gewählten Präsidenten Wiktor Janukowitsch herbeizuführen. In Donezk versammelten sich vor zwei Denkmälern die Anhänger der einen wie der anderen Option: die Sympathisanten des Euromaidan vor der Statue des ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko, die Unterstützer des Präsidenten vor dem Lenindenkmal. Aber in beiden Fällen waren es jeweils nur ein paar Dutzend Personen, die zusammenkamen.¹
Sowjetisches Nachleben
Über die Gründe dieser politischen Passivität der Donbassbevölkerung ist viel spekuliert worden. Der linke ukrainische Sozialwissenschaftler Wolodimir Ischtschenko nennt mehrere Faktoren, unter anderem die soziale Stabilität auf niedrigem Niveau, die die Beschäftigung in den von »politischen Kapitalisten« (Oligarchen) angeeigneten schwerindustriellen Betrieben der Region im Vergleich zum sozialen Kahlschlag der Transformationsjahre geboten habe. Die Kehrseite dieser Stabilität sei ein erzwungenes soziales Wohlverhalten gewesen, weil die Entlassung einem Sturz ins Nichts gleichgekommen wäre. Die Leute im Osten hätten, so der Autor, die bestehenden Verhältnisse passiv, aber ohne jeden Enthusiasmus unterstützt.²
Das heißt nicht, dass diese Menschen keine politischen Überzeugungen gehabt hätten. Sie waren in der sowjetischen Zeit sozialisiert worden. Sie verbanden mit dieser Epoche die kollektive Erinnerung daran, dass der auf seiner harten Arbeit beruhende Donbass das führende Industriegebiet des Landes gewesen war. Ihren Malocherstolz hatten sie in eine spezifische Form des regionalen Patriotismus transformiert.³ In den Wochen des Maidan war in Donezk und vielen anderen Städten der Süd- und Ostukraine häufig das Argument zu hören: Wir arbeiten und halten die Ukraine am Leben, und diese westukrainischen Faulpelze randalieren in Kiew herum.⁴ Auch wenn man glaubt, darin »gesundes proletarisches Empfinden« erkennen zu können, sollte man übrigens nicht übersehen, dass das Ressentiments von der Art waren, die 1968 die Springer-Presse gegen die protestierende APO mobilisierte und an die Holger Börner in seinem berühmten »Dachlattenzitat« von 1982 appellierte.⁵
Hinzu kam, dass das Konzept der ukrainischen Ethnonation, wie es die ukrainischen Rechten vertraten, im multinationalen Donbass keine Erfahrungsgrundlage hatte. Die Region war im Zuge zweier Industrialisierungswellen im Zarenreich und in der Sowjetunion von Zuwanderern aus den verschiedensten Teilen des jeweiligen Landes besiedelt worden, und es gab zahlreiche national gemischte Familien. Noch bei der Volkszählung von 2012 gaben in Donezk nur 29 Prozent der Bewohner an, sich als Bürger der Ukraine zu fühlen, dagegen 27 als Bürger von Donezk und weitere 24 Prozent als Bürger des Donbass.⁶ Ein regionales Selbstbewusstsein hatte also eine knappe Mehrheit. Da das Russische in der Sowjetunion nicht nur die politisch geförderte Lingua franca war, sondern auch individuell die Sprache des sozialen und Bildungsaufstiegs,⁷ sprach die multinationale Bevölkerung des Donbass überwiegend russisch, wenn auch mit teilweise starkem ukrainischem Akzent und oft in einem russisch-ukrainischen Mischdialekt namens »Surzhik«. Sprachfragen interessierten im Alltag niemanden, zumal das 2010 unter Janukowitsch verabschiedete Gesetz über Regionalsprachen das Russische überall dort faktisch zur zweiten Amtssprache machte, wo mindestens 20 Prozent der Bevölkerung sich dieser Sprache bedienten.
Ausgerechnet dieses Sprachengesetz, das perspektivisch die Chance geboten hätte, die Ukraine über die kulturellen Trennlinien zwischen ihren Bewohnern hinweg zu befrieden, wurde in den letzten Februartagen als eine der ersten Amtshandlungen der neuen, aus dem Euromaidan hervorgegangenen Regierung aufgehoben. Übergangspräsident Olexander Turtschinow legte zwar sein Veto gegen diese Aufhebung ein, weil er erkannte, welches Destabilisierungspotential darin schlummerte, aber der Schaden war angerichtet. Die russischsprachige Bevölkerung der Ukraine nahm die Neuerung als einen Angriff auf ihre angestammte Lebensweise wahr. Genauso war es mit den sowjetischen Denkmälern, die im Zuge des Euromaidan in der Westukraine massenweise gestürzt worden waren. Im Osten musste man nicht viel über Lenin wissen, um sich zu seinen Füßen zu einem Rendezvous zu verabreden. Er gehörte halt zum Stadtbild. Sowjetische Alltagskultur.
Russlandnostalgische Stimmungen
Der Euromaidan hatte einen im Kern politischen Streit um die Eingliederung der Ukraine in die Hegemoniesphäre der EU bzw. in die »Eurasische Wirtschaftsunion« Russlands ethnonationalistisch aufgeladen. Dahinter spielten sich auch Klassenkonflikte zwischen Fraktionen der Bourgeoisie wie auch der Arbeiterklasse ab.⁸ »Wer nicht hüpft, ist Moskowiter«, hatten sie auf dem Maidan skandiert. Das war der Ausgangspunkt dafür, den Widerstand gegen die vom Euromaidan ausgehenden Neuerungen auch auf der Gegenseite zu ethnisieren und so großrussischem Nationalismus ein Einfallstor in die Stimmungen im Osten zu liefern. Welcher Sprache man sich bediente, wurde zum politischen Unterscheidungskriterium.
Diese Entwicklung kam im Frühjahr 2014 nicht spontan zum Ausbruch. Eine Mehrheit der Donbassbewohner hatte 1991 beim Unabhängigkeitsreferendum mit »Ja« gestimmt, weil die Leute sich davon erhofften, dass die sozialen Bedürfnisse ihrer Region in einem Land, in dem sie die einzigen Produzenten von Kohle und Stahl wären, besser berücksichtigt würden als in der Sowjetunion, die in Sibirien und Zentralasien billiger zu erschließende Rohstofflagerstätten gefunden und den Donbass seit den 1970er Jahren vernachlässigt hatte.⁹ Einer der Anführer eines großen Bergarbeiterstreiks im Jahre 1990 hatte seinerzeit erklärt: »Der ökonomische Zustand des Donbass kann uns dazu zwingen, die Selbstbestimmung politisch zu unterstützen, weil eine unabhängige Ukraine den Donbass und seine Kohle braucht, die, auch wenn man es nicht wahrhaben will, im Vergleich zur kasachischen und russischen teurer ist und immer teurer sein wird. Die Wirtschaft kann uns dazu zwingen, uns derjenigen Politik zuzuwenden, die uns nicht naheliegt.«¹⁰
In dem Maße, in dem diese Hoffnungen in der unabhängigen Ukraine nicht erfüllt wurden und im Unterschied zu ihr sich in den 2000er Jahren in Russland die Lebensverhältnisse auch für die breitere Bevölkerung verbesserten, kam auch im Donbass eine »russlandnostalgische« Stimmung auf. Seit etwa 2010 erschienen, oft verfasst von Autoren aus dem Donbass, reißerische Historical-Fiction-Romane mit Titeln wie »Die ukrainische Front. Rote Sterne über dem Maidan«, »Der zerbrochene Dreizack« oder »Die Ukraine im Feuer. Die Zeit der Totgeborenen«, die einen künftigen russisch-ukrainischen Krieg an die Wand malten, der sich unter anderem im Donbass abspielen würde.¹¹ Sie verkauften sich teilweise in mehreren Auflagen, was zeigt, dass es ein Bedürfnis nach solcher Nostalgie gab.
Keine Abspaltungspläne
Dies alles waren bis zum Euromaidan mehr oder minder latente Stimmungen, und es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass sie ohne die Aufkündigung des »historischen Kompromisses« mit der Ostukraine durch den Euromaidan größere politische Folgen gehabt hätten.
Dann trat Russland auf den Plan. Die ebenfalls in den ersten Tagen der Maidan-Regierung verkündete Absicht, das unter Janukowitsch 2012 im Tausch gegen einen russischen Milliardenkredit – faktisch eine Subvention – bis 2042 verlängerte Stationierungsabkommen für die Schwarzmeerflotte auf der Krim fristlos aufzukündigen (obwohl der Vertragstext keine Kündigungsklausel enthielt), veranlasste die Moskauer Führung, einen wohl bereits existierenden Notfallplan aus der Schublade zu holen, dessen Folgen in Gestalt der Loslösung der Krim von der Ukraine und ihres Anschlusses an Russland allgemein bekannt sind. Gegen den Willen der örtlichen Bevölkerung – mit Ausnahme der krimtatarischen Minderheit – musste dieses Programm nicht durchgesetzt werden. Die Bewohner der Krim waren überwiegend ethnische Russen, viele von ihnen erst nach 1945 auf die kriegszerstörte Halbinsel umgesiedelt, um für die Basen der Schwarzmeerflotte eine minimale zivile Infrastruktur zu schaffen. Sie waren 1954 nicht gefragt worden, als der geborene Ukrainer Nikita Chruschtschow die Krim zum Zeichen der Verbundenheit des russischen und des ukrainischen Volkes an die ukrainische Sowjetrepublik übertragen hatte. Sie wurden auch 1991 nicht gefragt, als die sowjetische Zentrale nicht mehr daran interessiert war, auf das Ergebnis eines regionalen Referendums für eine Autonomie der Krim im Rahmen der UdSSR, also ohne zwischengeschaltete ukrainische Unionsrepublik, einzugehen.
So weit wie auf der Krim gingen die Absichten der Bevölkerung im Donbass anfangs nicht. Statt dessen griffen regionale Politiker, die zuvor noch in der »Partei der Regionen« organisiert gewesen waren, eine Forderung dieser Partei von Anfang 2014 wieder auf: die Föderalisierung der Ukraine.¹² Was die den prowestlichen Protesten politisch nicht gewachsene alte Regierungspartei vorgeschlagen hatte, um den politischen Zerfall des Landes, der sich in der Konfrontation auf dem Maidan abzeichnete, noch abzuwenden, war für diejenigen, die die Auseinandersetzung um die Macht in Kiew gewonnen hatten, nicht zu akzeptieren. Denn es hätte bedeutet, die Tragweite ihres Sieges gleich wieder zurückzunehmen.
Die Forderung nach einer Föderalisierung der Ukraine, also der Aufwertung der Regionen zu Lasten des Zentralstaats, kam auch Russland nach der Schlappe des Staatsstreichs in Kiew gerade recht. Denn man machte sich in Moskau Hoffnungen, über die Stimmrechte der ost- und südukrainischen Gebiete in einer zweiten Parlamentskammer nach dem Vorbild des deutschen Bundesrates die Westdrift der Ukraine aufhalten oder doch wenigstens bremsen zu können. Genau aus diesem Grund gab es in Kiew und bei seinen Protektoren im Westen nie ein Interesse daran, diese Option auszutesten. Auch nicht, als sie verklausuliert Eingang in die beiden Minsker Abkommen fand, von denen Angela Merkel Ende 2022 zugegeben hat, dass sie ein Täuschungsmanöver waren, um der Ukraine Zeit zur Aufrüstung zu geben.¹³
Anfangs hatte der Gedanke einer Abspaltung von der Ukraine auch im Donbass keine gesellschaftliche Mehrheit. Nach Umfragen, die im März 2014 noch von Kiewer Meinungsforschungsinstituten durchgeführt worden waren, wurde die Option eines Austritts der Region aus der Ukraine mit der Perspektive des Anschlusses an Russland oder der Gründung eines unabhängigen Staates im Donbass nur von knapp 20 Prozent der Befragten befürwortet. In anderen Landesteilen lag die Zustimmung noch weit niedriger. Aber auf die anschließende Frage, ob es in der Ukraine so tiefgreifende politische und kulturelle Unterschiede gebe, dass ein Zerfall des Landes möglich sei, antworteten im Donbass knapp 60 und im Süden der Ukraine, den Gebieten Odessa, Mikolajiw und Cherson, knapp 50 Prozent der Befragten mit »Ja«.¹⁴ Das waren genau die Teile der Ukraine, für die im russischen politischen Sprachgebrauch damals wieder die bereits zu Zarenzeiten gebräuchliche Bezeichnung »Neurussland« (Noworossija) aufkam.
Antimaidan
Entsprechend reagierte die Kiewer Regierung auf diese für ihre Herrschaft über das ganze Land bedrohlichen Tendenzen. Kolonnen des »Rechten Sektors« wurden in Marsch gesetzt, um im Südosten des Landes Macht zu demonstrieren. Gepanzerte Militärkolonnen rollten durch Städte, hier und dort aufgehalten durch Straßenblockaden. So scheiterte im März ein Versuch des »Rechten Sektors«, den ukrainisch-russischen Grenzübergang in Nowoasowsk im Bezirk Donezk zu übernehmen, weil örtliche Aktivisten – aber auch die lokale Polizei – die Fahrzeuge nicht durchließen. In Kiew wurde später zur Gesichtswahrung erklärt, die Kolonne sei mit technischen Problemen liegengeblieben. Das Pogrom von Odessa am 2. Mai 2014 war also allenfalls dem Ausmaß nach ein »Einzelfall«. Historisch gesehen war das Vorgehen beider Seiten Teil einer Strategie, zu zeigen, wer wo das Sagen hatte.
In den größeren Städten kopierten Aktivisten des »Antimaidan« Handlungsmuster, die Anfang des Jahres von Organisationen wie dem »Rechten Sektor« in Kiew und im Westen der Ukraine vorexerziert worden waren: die Besetzung von Amtsgebäuden, Kasernen und Polizeiwachen, um an Waffen zu kommen. Immer öfter gerieten Teilnehmer von »proukrainischen« und »prorussischen« Kundgebungen aneinander. Mitte März gab es in Donezk die ersten Toten auf beiden Seiten. Inhaltlich forderten die Redner auf den Kundgebungen, im Donbass ein Abspaltungsreferendum nach dem Vorbild der Krim zu veranstalten. Eine Reportage von damals hob hervor, es habe unter den Demonstranten keine Betrunkenen gegeben; die Leute, darunter »viele nett aussehende Jungens und Mädchen«, hätten sich diszipliniert verhalten und seien »ordentlich gekleidet« gewesen. Die Polizei schaute dem Geschehen zu und griff nicht ein.¹⁵
Das lag sicherlich auch daran, dass die örtlichen Sicherheitsbehörden zur Zeit der Herrschaft der »Partei der Regionen« mit eigenen Leuten besetzt worden waren und dass viele höhere Chargen der Polizei zu diesem Zeitpunkt weder wussten, worauf die Entwicklung hinauslaufen würde, noch was das für ihre persönliche Zukunft bedeuten würde. Zudem waren nach dem Machtwechsel in Kiew und der Auflösung der zu Bekämpfung des Euromaidan eingesetzten Polizeieliteeinheit »Berkut« viele von deren Angehörigen in den Donbass gekommen, wo sie sich vor Verfolgung durch die neuen Machthaber vergleichsweise sicher fühlten.
In den ersten Wochen der Auseinandersetzung versuchten zeitgenössischen Medienberichten zufolge noch viele Bürger des Donbass, Gewalt zu verhindern: Vor allem Frauen stellten sich zwischen die Aktivisten der streitenden Lager und hofften zu deeskalieren. Das passte auf der »prorussischen« Seite nicht allen. Im April kam Igor Girkin, Kampfname »Strelkow«, an der Spitze eines Kommandos von etwa 50 prorussischen Paramilitärs von der Krim in den Donbass. Er beklagte sich in sozialen Medien über die politische »Schläfrigkeit« der Bewohner. Mit seiner Truppe stürmte er im Handstreich die Verwaltung der Stadt Slowjansk im Nordwesten des Bezirks Donezk. Später rühmte er sich, es sei sein Werk gewesen, die »Fackel des Krieges in den Donbass getragen« zu haben: »Wenn unsere Einheit nicht über die Grenze gekommen wäre, wäre alles so ausgegangen wie in Charkiw und in Odessa«, zitierte ihn später die Süddeutsche Zeitung.¹⁶
Das dürfte etwas übertrieben gewesen sein: »Strelkows« Kolonne vereinte sich mit etwa 150 ehemaligen Mitarbeitern von Polizei und Geheimdienst, 250 Angehörigen eines »Kosakenaufgebots« und etwa 650 paramilitärischen Kämpfern aus Charkiw und Lugansk, wie die Bürgermeisterin von Slowjansk später angab.¹⁷ Es gab gleichwohl eine lokale Basis für den Aufstand. Die Eroberung der Stadt am 12. April 2014 geschah kampflos.
»Antiterroroperation«
Einen Tag später beschloss die ukrainische Regierung, gegen den aufständischen Donbass eine »Antiterroroperation« zu starten. Von nun an rollten Panzer, bombardierten Kampfflugzeuge militärische und nichtmilitärische Ziele der Aufständischen, schoss ukrainische Artillerie auf Wohngebiete im Hinterland. 2016 ergab eine Auswertung der 2014 installierten Beobachtermission der OSZE, dass auf seiten der Ukraine mehr Soldaten als Zivilisten getötet worden seien, auf seiten der Aufständischen sei das Verhältnis umgekehrt gewesen.¹⁸ Das lässt ebenso wie eine Äußerung des im Mai 2014 zum Präsidenten der Ukraine gewählten Petro Poroschenko, dass »ihre Kinder im Keller sitzen sollen, während unsere in die Schule gehen«¹⁹, darauf schließen, dass Terror gegen die unbotmäßige Zivilbevölkerung ausdrücklich Teil der ukrainischen Kriegführung war.
Entsprechend radikalisierte sich die Stimmung der Bevölkerung im Donbass rasch. Als am 11. Mai 2014 in den unter Kontrolle der Aufständischen stehenden Teilen der Region ein Referendum über die staatliche Unabhängigkeit stattfand, notierte der Zürcher Tages-Anzeiger in einer Warteschlange vor einem Abstimmungslokal Äußerungen wie »Ich will nichts mehr von der Ukraine hören« oder »Wir wollen diese Banditen in Kiew nicht«. Illusionen machten sich die Anstehenden nicht: »Wenn wir unabhängig werden, wird das zuerst hart sein, doch alles ist besser, als mit den Faschisten zu leben.«²⁰ Derweilen verließ der »proukrainische« Teil der Bevölkerung im Frühjahr 2014 zu großen Teilen die Region. Insofern ist das Ergebnis von knapp 90 Prozent für die Abspaltung von Kiew bei zehn Prozent Gegenstimmen²¹ plausibler, als es die in der westlichen Berichterstattung systematisch geschürten Zweifel glauben machen wollen. Bei einem Besuch in der inzwischen ausgerufenen »Volksrepublik Donezk« im Juli 2014 notierten die polnischen und insofern übermäßiger Sympathie für die »Separatisten« unverdächtigen Reporter Grzegorz Szymanik und Julia Wizowska als Statement der Bewohner eines durch ukrainischen Beschuss zerstörten Hauses in Donezk: »Sind wir etwa mit Panzern nach Kiew gefahren?«²² Wenige Tage nach den Referenden wurden die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk ausgerufen.
Der Krieg führte auf beiden Seiten zu einer Verrohung der Sitten. Wer im Donbass noch Sympathien für das Projekt Ukraine erkennen ließ, lebte gefährlich. Im Sommer 2014 ging ein Bild durch die Weltmedien, das eine an einen Laternenpfahl gefesselte Frau zeigte, der eine andere in den Unterleib tritt. Die Gefesselte trug ein Schild vor der Brust »Ich habe unsere Kinder getötet und bin eine Agentin der Mörder«.²³ Ihr Verbrechen: Sie hatte Suppe für die Donezk belagernden ukrainischen Truppen gekocht und war bei dem Versuch erwischt worden, die Töpfe durch die Linien zu schmuggeln.
Welche Rolle hat Russland bei der Auslösung des Aufstandes gespielt? Welches Ausmaß die informelle Unterstützung für das Netzwerk prorussischer »Nichtregierungsorganisationen« in der Ukraine hatte, ist schwer zu rekonstruieren. Es gibt Hinweise, dass Leute, die später führende Positionen in den »Volksrepubliken« einnahmen, seit etwa 2010 russisch-patriotische Wehrsportvereine, Box- und Motorradklubs und dergleichen organisiert haben.²⁴ Aus späteren kritischen Äußerungen von russischer Seite geht hervor, dass es ein entsprechendes Programm gegeben haben dürfte, das aber nur nachlässig realisiert wurde – unter anderem angeblich, weil hohe Kreml-Beamte das dafür bereitgestellte Geld in die eigene Tasche gesteckt hätten. Das soll einer der Gründe dafür gewesen sein, dass der jahrelang für ukrainische Fragen zuständige hohe Kreml-Beamte Wladislaw Surkow 2020 seinen Posten verlor.
Offiziell hielt sich die Regierung in Moskau im Frühjahr 2014 bedeckt. Girkins Truppe, die Slowjansk besetzte, gehörte nicht der regulären russischen Armee an, sondern der irregulären »Volkswehr« der Krim. Auch andere Russen mit militärischer Erfahrung waren offiziell »Freiwillige« oder allenfalls »beurlaubt«. Informell unterstützte Russland die beiden Republiken aber durchaus: einerseits wirtschaftlich; andererseits, indem es ihre militärische Niederlage, die im Sommer 2014 eine Frage von Tagen zu sein schien, durch dosierten Einsatz eigener Truppen verhinderte. Etwa, als es im Juli 2014 eine »Buk«-Raketenbatterie an die »Volksmiliz« der Republik Donezk »auslieh«, die dann irrtümlich damit keine ukrainische Militärmaschine abschoss, sondern ein malaysisches Passagierflugzeug, das unvorsichtigerweise den umkämpften Luftraum über dem Donbass nutzte. Oder als russischer Artilleriebeschuss dazu beitrug, im August 2014 den ukrainischen Vormarsch bis an die Grenze zu stoppen und das ukrainische Expeditionskorps anschließend in der Kesselschlacht von Ilowajsk zu vernichten. Ohne diese Schlacht wären die »Volksrepubliken« eine Episode geblieben.
Es dauerte bis zum 21. Februar 2022, drei Tage vor dem Beginn des Krieges, bis Moskau die als Ergebnis des Referendums proklamierten »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk offiziell anerkannte. Unmittelbar vor dem Abspaltungsreferendum hatte Wladimir Putin noch an die Aufständischen appelliert, die Abstimmung zu verschieben. Als sie gleichwohl erfolgt war, rief er dazu auf, einen »Dialog auf Augenhöhe« zwischen der Regierung in Kiew und den »Vertretern des Südostens« aufzunehmen.²⁵
Das macht den grundlegenden Unterschied der russischen Strategie in Sachen Krim und Donbass deutlich. An einer Eingliederung des Donbass nach dem Vorbild der Krim bestand in Moskau 2014 kein Interesse; daran, einen Strukturkonflikt in der Ukraine auf kleiner Flamme am Kochen zu halten, durchaus. In der Sprache der politischen Ökonomie ausgedrückt: An der Krim war Russland aufgrund des militärischen Gebrauchswerts interessiert, am Donbass dagegen wegen des potentiellen »Tauschwerts« gegenüber der Ukraine. Erst als klar war, dass dieser »Tauschwert« nicht existierte, weil die Ukraine an verfassungspolitischen Kompromissen nicht interessiert war und der Westen ebenso wenig an einem sicherheitspolitischen Kompromiss mit Russland, erfolgte die Anerkennung. Als diplomatisches Vorspiel zum Krieg.
Anmerkungen
1 So jedenfalls aus eigenem Augenschein die polnischen Journalisten Grzegorz Szymanik und Julia Wizowska. Vgl. dies.: Po północy w Doniecku (Nach Mitternacht in Donezk), Warschau 2016, S. 25
2 Wolodimir Ischtschenko: Towards the Abyss. Ukraine from Maidan to War, London/New York 2024, S. 25 f.
3 Vgl. Reinhard Lauterbach: Bürgerkrieg in der Ukraine. Geschichte, Hintergründe, Beteiligte, Berlin 2015, S. 113 ff.; Marta Studenna-Skrukwa: Ukraiński Donbas: Oblicza tożsamości regionalnej (Der ukrainische Donbass. Erscheinungsformen einer regionalen Identität), Poznań 2014
4 Szymanik/Wizowska, a. a. O., S. 26
5 https://www.lagis-hessen.de/de/subjects/idrec/sn/edb/id/5015
6 Szymanik/Wizowska, a. a. O., S. 48
7 Vgl. die persönlichen Erinnerungen von Ischtschenko im Vorwort zu seiner Studie.
8 Vgl. im einzelnen Ischtschenko, a. a. O., S. 25 f.
9 Vgl. Andreas Wittkowsky: Fünf Jahre ohne Plan. Die Ukraine 1991–1996, Hamburg 1998, S. 43 f.
10 Zit. n. ebd., S. 44
11 Vgl. Szymanik/Wizowska, a. a. O., S. 7 ff., Bibliographie ebd., S. 198
12 https://www.dw.com/de/ukraine-als-föderation-fluch-oder-segen/a-17403087
13 Vgl. https://www.fr.de/politik/von-putins-luegen-und-merkels-unwahrheiten-92037711.html
14 https://laender-analysen.de/ukraine-analysen/132/ukraineanalysen132.pdf, S. 17 ff.
17 https://ru.wikipedia.org/wiki/Бои_за_Славянск_(2014)
18 Vgl. Reinhard Lauterbach: Glaube keiner Statistik …, junge Welt, 20./21.8.2016
19 Die Äußerung fiel am 27. Oktober 2014 in Odessa. Auch die »proukrainische« Website »faktcheck.ge« gibt zu, dass Poroschenko diese Worte wählte, bezeichnet es aber gleichwohl als »Desinformation« und »Rechtfertigung des russischen Krieges«, sie zu zitieren. https://factcheck.ge/ru/story/41935-дезинформация-в-2014-году-петр-порошенко-угрожал-войной-жителям-донбасса
20 https://www.tagesanzeiger.ch/wir-wollen-nichts-mehr-von-der-ukraine-hoeren-505069283453
21 https://newsv2.orf.at/stories/2229586/
22 Szymanik/Wizowska, a. a. O., S. 93
23 Vgl. ebd., S. 103
24 Vgl. Szymaik/Wizowska, a. a. O., S. 44 ff.
25 https://de.wikipedia.org/wiki/Referendum_im_Osten_der_Ukraine_2014#cite_ref-SPON_September_25-1
Reinhard Lauterbach schrieb an dieser Stelle zuletzt in der Ausgabe vom 24./25. Februar über den laufenden Ukraine-Krieg.
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
Dieser Artikel gehört zu folgenden Dossiers:
Ähnliche:
 Emeric Fohlen/NurPhoto/ZUMA Press/imago19.03.2022
Emeric Fohlen/NurPhoto/ZUMA Press/imago19.03.2022Nicht dialog-, nicht friedenswillig
 Jens Malling16.07.2016
Jens Malling16.07.2016Die Hoffnung stirbt zuletzt
 REUTERS/Host Photo Agency/RIA Novosti23.05.2015
REUTERS/Host Photo Agency/RIA Novosti23.05.2015Zarenadler und rote Fahne

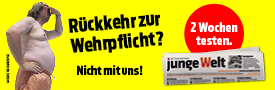
– Die Annahme einer ukrainischen Militärdoktrin durch das Kiewer Parlament, die die Rückeroberung der Krim und des Donbass vorschrieb, im Frühjahr 2021.
– Die dementsprechende Weigerung Jermaks, des »starken Mannes« in Selenskijs Kriegskabinett, bei Verhandlungen am 10. Februar 2022 in Berlin, das zweite Minsker Abkommen und damit den Waffenstillstand überhaupt noch zu erwähnen, und
– die volle Wiederaufnahme des Beschusses der Donbassstädte am 17. Februar 2022 durch die dort konzentrierte ukrainische Armee. Woraufhin es zu ersten Evakuierungen von Frauen und Kindern kam. (Alles bei Schölzel/Lauterbach nachzulesen!) Zufall?
Doch nur so ist m. E. zu erklären, warum Putin den vollen militärischen Beistand schließlich doch gewähren musste – das russische Volk war da entschlossener als die vorwiegend prowestliche Oligarchie Russlands.