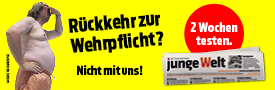Vom Eise befreit
Von Felix Bartels
Während Westeros sich auf den Winter vorbereitet, hat man auf der echten Erde das entgegengesetzte Problem. Die – bekanntlich – erwärmt sich. Dabei geht es um weit mehr als lediglich höhere Temperaturen. Auch die ausgeformtesten Modellrechnungen können nicht präzise vorhersagen, welche Auswirkungen die Störungen des Geosystems haben werden, sobald die bekannten Kippunkte überschritten sind. Sicher ist nur, dass sie nicht gering sein werden. Ein Marker der allmählichen Erwärmung ist das Eis der Pole.
Seit 1978 registrieren Satelliten das Schrumpfen der Eismassen im Arktischen Ozean. Diese Massen unterliegen bedingt durch die Temperaturschwankungen im Jahreslauf ohnehin einem Zyklus. In den kalten Monaten wachsen sie, in den warmen schrumpfen sie. Mit der durch den Klimawandel bewirkten Erwärmung steigt allerdings der Grundwert der Temperatur, um den das saisonale Wetter schwankt. Das absolute Schrumpfen der Eismassen macht die Frage nötig, wann der Punkt erreicht ist, an dem der Arktische Ozean phasenweise im Jahr eisfrei sein wird. Wie die Fachzeitschrift Nature Reviews Earth & Environment berichtet, hat ein Forschungsteam um Alexandra Jahn von der University of Colorado Boulder ein Spektrum von Prognosen errechnet, die den Zeitraum bestimmen sollen, in dem das Meer um den Nordpol erstmals eisfrei sein wird. Demnach könnte der Tag X bereits in den 2020er oder 2030er Jahren eintreten, mit Sicherheit aber wird in den 2050er Jahren der Arktische Ozean erstmals für ein paar Tage ohne Eis sein.
»Eisfrei« bedeutet allerdings nicht simpel: »ohne jegliche Eismengen«. Definiert wird der Zustand dadurch, dass weniger als eine Million Quadratkilometer Eis im Ozean vorhanden sind. Diese Setzung berücksichtigt das Vorhandensein zweier Ballungspunkte von großen Eismassen, nördlich Grönlands und Kanadas, die der Erwärmung des Ozeans noch lange Zeit widerstehen werden und somit wenig Relevanz für die Frage des grundlegenden Abschmelzens besitzen. Der Prozess ist dagegen evident. In den zurückliegenden 17 Jahren wurden die 17 geringsten Ausdehnungen des Arktischen Meereises registriert, 2023 lag das Minimum am 19. September bei 4,23 Millionen Quadratkilometern, dem sechstniedrigsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen.
2 Wochen kostenlos testen
Die Grenzen in Europa wurden bereits 1999 durch militärische Gewalt verschoben. Heute wie damals berichtet die Tageszeitung junge Welt über Aufrüstung und mediales Kriegsgetrommel. Kriegstüchtigkeit wird zur neuen Normalität erklärt. Nicht mit uns!
Informieren Sie sich durch die junge Welt: Testen Sie für zwei Wochen die gedruckte Zeitung. Sie bekommen sie kostenlos in Ihren Briefkasten. Das Angebot endet automatisch und muss nicht abbestellt werden.
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Heinrich H. aus Stadum (13. März 2024 um 00:28 Uhr)»Auch die ausgeformtesten Modellrechnungen können nicht präzise vorhersagen«, wie denn auch? Die Modelle sind nicht kausal, weil man die kausalen Zusammenhänge nicht (vollständig) kennt. Sie können also nur das berechnen oder vorhersagen, was in ihnen angelegt ist. Testen tut man sie, indem man ihnen Rand- und Anfangsbedingungen bekannter historischer Vorgänge vorgibt – soweit sie halt bekannt sind. Dann schaut man, ob die Modelle das Ausspucken, was man auch – mehr oder weniger – gut kennt. Bei hinreichender Übereinstimmung nennt man das Modell »gut« und erlebt seit vielen Jahren, dass man Entwicklungen »unterschätzt« hat oder sie »stärker als erwartet« waren. Entsprechend den neuen Erkenntnissen werden die Modelle laufend verbessert, bleiben aber heuristisch. Ob Wolkenbildung oder Strömungen in der antarktischen See, vieles ist nur unvollständig erkannt/bekannt und fließt nicht oder fehlerhaft in die Modelle ein. Zum theoretischen Mangel kommt praktisch die beschränkte Datenmenge. Allerdings sind die Modelle gut genug, dass man sich schnellstens hinsichtlich der Treibhausgasemissionen auf null orientieren sollte.
-
Leserbrief von Onlineabonnent/in Marcus B. (13. März 2024 um 13:24 Uhr)»Man erlebt seit vielen Jahren, dass man Entwicklungen ›unterschätzt‹ hat oder sie ›stärker als erwartet‹ waren.« Ein sehr guter Punkt. Das liegt aber nicht ausschließlich an den Modellen, sondern an den ausgewählten Szenarien, die diese ausspucken, z. B. beim IPCC. Während man eigentlich immer vom Schlimmsten ausgehen und auf Beste hoffen sollte, ist es bei den Berichten manchmal umgekehrt. Na ja, nicht ganz. Man nimmt aber die eher moderaten Szenarien als »wahrscheinlich« an, um dann »überrascht« festzustellen, dass doch das schlimmste Szenarium die korrektere Wahl gewesen wäre. Das soll bitte nicht als IPCC-Bashing verstanden werden; die geben ihr Bestes. Aber der politische Druck von außen ist enorm, doch bitte mit etwas Lippenstift das Schwein aufzuhübschen und das Stück Kot noch ein bisschen zu polieren. Das ist kurzsichtig und kontraproduktiv, aber darum machen sich Politiker mit einem Horizont, der höchstens bis zur nächsten Wahlperiode reicht, eben keinerlei Gedanken. Allerdings kann man das denen ja auch nicht recht zum Vorwurf machen, denn die Wähler würden ihnen ja sonst davonlaufen, zu denen mit dem besser geschminkten Schwein.
-
Mehr aus: Natur & Wissenschaft
-
Die Sache des Administrators
vom 12.03.2024